
Martin Kasper im Wasserschloss Glatt, ›Vertigo‹, Text: Hans-Joachim Müller hrsg: Bernhard Rüth, Modo-Verlag, Freiburg http://modoverlag.de »
mehr»
mehr»
Umbau
Die neueren Bilder von Martin Kasper mit den älteren zusammengesehen
Hans-Joachim Müller
Als hätte man geklingelt, und der Maler hätte geöffnet, die Vorhänge weit aufgezogen, und man stünde nun vor „Saal“, „Halle“, „Korridor“, „Space“, „Passage“. Und niemand da. Und alles ausgeräumt. Funktionslose Leere. Stilles Raumtheater. So ist es immer bei Martin Kasper. So ist es immer beschrieben worden. Und auch heute ist es noch so. Und ist doch ein bisschen anders.
Vor Jahren haben einen die Bilder irgendwohin geführt - an Orte, die es vielleicht gibt oder auch nicht gibt, die man so oder ähnlich schon mal gesehen zu haben meint. Es war wie eine Einladung zum behutsamen Verharren vor Sälen und Hallen, deren architektonischer Stolz sichtlich gelitten hat. Die Zeit muss durch sie gefegt sein, als hätten jahrelang die Fenster offen gestanden. Von Leben keine Spur mehr - oder eben doch lauter Spuren rätselhaft abgetanen Lebens. Dann und wann auch mal Figurenschemen, die wie platonische Schatten an irgendeine Tätigkeit erinnern, ohne wirklich da zu sein. Und wenn Martin Kasper auch nie Geschichten erzählt hat, dann ging die Faszination vor seinen Bildern nicht selten mit klopfendem Herzen einher. Als im Jahr 2013 Marion Poschmanns Roman „Die Sonnenposition“ herauskam, und man mit leichtem Gruseln dem „rundlichen Rheinländer Altfried Janich“ ins verfallene „Ostschloss“ folgte, wo er in der Psychiatrie seine albtraumhaften Tage und Nächte erlebt, da schien es fast zwingend, an Martin Kaspers Bilder zu denken, die sich einem bei der Lektüre wie Kulissen vor die Sinne schoben.
Noch immer spielt alles drinnen. Dass der Maler rausginge, sich draußen umsähe, das kommt nicht vor. Nie steht er am Fenster wie Goethe in seiner römischen Wohnung am Corso, oder wie Adolph Menzel sein Balkonzimmer malt, durch dessen Fenstertüren der Tag wie ein sonniges Versprechen hereinweht. Martin Kaspers Fenster, wenn es sie denn gibt, sind blind. Er übernimmt sie als Zeichen für die Raumkonzepte der Moderne, die allesamt den umständelosen Blick durchs Bildfenster zur Welt verstellen. Denn bei allen blinden Flecken, die diese Moderne selber produziert hat, hat das doch zu ihren hellen Erkenntnisbeständen gehört, dass die wahren und die unwahren Bilder alle auf der Netzhaut entstehen unter tatkräftiger Hilfe benachbarter Hirnlappen. Vergeblich die alte Hoffnung, man bräuchte nur die Fenster der schönen Bildillusion zu öffnen, um noch einmal die sichtbare Welt wahrheitsgemäß abzubilden. Solches Zutrauen ist im Mahlwerk der Avantgarden gründlich zerrieben worden. Und so sind auch Martin Kaspers Fenster bis heute geschlossen geblieben.
Aber das Drinnen ist sichtlich komplexer geworden. An der Frontalität hat sich nichts geändert, und auch die wahrnehmungstechnische Opposition - hier starrer Betrachter, dort starre Raumbühne - gilt noch immer. Oder vielleicht nur vorerst noch. Denn die Offenheit der Architekturen scheint längst nicht mehr so ohne Weiteres gewährleistet. Manches mutet jetzt verstellter an, verschachtelter. Nicht selten irrt der Blick umher, findet keinen Halt in der undurchschaubaren Logik der Vorhallen, der Flure, der Treppen-Auf- und Abgänge. Auch erscheinen die Räume auf ein tiefes Hinten konzipiert, münden in unübersichtlichen Korridoren, verlieren sich in unendlichen Fluchten - wie in Großflughäfen, in denen man auf kilometerlangen Rollbändern sein irgendwo in der Ferne liegendes Gate ansteuert. Oder in der Metro, wenn man beim Umsteigen an den Kreuzungsstationen durch die gekachelten Röhren hetzt.
Kafka fällt einem ein. „Der Prozess“, dessen ungemeine Suggestion mit dem halluzinierenden Raumerlebnis des schuldig unschuldigen Delinquenten K. zusammenfällt, der sich zögerlich wie im Traum, in dem man nicht von der Stelle kommt, dem Haus nähert, in dem der Untersuchungsrichter auf ihn wartet: „Das Haus lag ziemlich weit, es war fast ungewöhnlich ausgedehnt, besonders die Toreinfahrt war hoch und breit. (…) K. wandte sich der Treppe zu, um zum Untersuchungszimmer zu kommen, stand dann aber wieder still, denn außer dieser Treppe sah er im Hof noch drei verschiedene Treppenaufgänge und überdies schien ein kleiner Durchgang am Ende des Hofes noch in einen zweiten Hof zu führen.“
Das könnte auch eine Bauanleitung für den Innenarchitekten Martin Kasper sein. Und ob Untersuchungszimmer oder nicht, es sind Räume mit starkem Sog. Das hat sie schon immer ausgezeichnet. Jetzt kommt einem die Schwerkraft, die einen vor den Bildern hält, fast wie ein Rätsel vor. Eigentlich müsste man angesichts der Energie der Arrangements wie von schwarzen Löchern verschlungen werden. So mischt sich in das psychische Erlebnis ein eigentümlich physisches, in die bedenkende Anschauung ein wunderliches Körpergefühl. Zumal diese Räume mit mancherlei ortsfremdem Inventar besetzt sind. Da und dort Stellwände, farblich abgesetzte Einbauten, als seien Kulissenteile verschiedenster Theaterstücke verschränkt und zusammengeschoben worden.
Und nicht weniger irritierend ist, wie die gemalten Bilder mit den Räumen, in denen sie auftreten, unübersehbar interagieren. Wie die Malerei hier in der Ausstellung im Wasserschloss Glatt Raumelemente zitiert, verfremdet, die noble Anmutung des Galerie-Westflügels aufgreift und sie bildnerisch reproduziert. Tatsächlich gewinnt jetzt die Bild-im-Bild-Idee, das alte Mise-en-Abyme-Verfahren eine neue und bestimmende Rolle. Es ist, als sei man eingeklemmt zwischen einem Spiegel vor einem und einem Spiegel im Rücken, in denen sich unser Spiegelbild unendlich vervielfältigt. Und so ist man unversehens zum Raum-Insassen geworden. Man steht nicht mehr einfach vor dem Bild und wahrt seinen Sicherheitsabstand und schaut wie im Theater auf die Bühne. Plötzlich ist man mitten im Stück selber.
Beim Großbild, das den lakonischen Titel „Halle“ trägt, könnte man an eine Messe-Koje denken mit verwirrenden Spiegelungen und ins Monochrome spielenden Farbteppichen an den Wänden und auf dem Boden. Überhaupt muss die Zunahme des Malerischen auffallen. Die dominanten Farben auf diesen Bildern sind nun nicht mehr nur die Lokalfarben. Es sind kultivierte Blitze, die da und dort aufleuchten und unversehens aus der Form geraten können. Dann lösen sie sich gestisch auf, als probten sie ihre Tauglichkeit für das informalistische Fach. Und mehr und mehr scheint sich die gewohnte Raum-Solidität in Samplings der verschiedensten Seheindrücke zu verwandeln.
Besonders eindrücklich lässt sich das an dem mit seinen vier Metern Spannweite ausgreifenden „Diptychon“ beobachten, das die bis dato an der rechtwinkligen Geometrie justierten Linien in einen Strudel verwandelt, der wie Wellen durch die unklaren Raumabteile spült. Im Wortsinn ist das Bild-Paar zum Zerrbild geworden, das fast alles, was es „drinnen“ zu sehen gibt, verbiegt und verbeult: Die Wände die reinste konkave Zumutung, die Bilder verquirlte Hard-edge-Malerei, die Türstürze wie mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommen. Dazu schweben Teile einer monströsen Ritterrüstung in der seltsam erregten Formlosigkeit, die sie umgibt, wie im schwerelosen Raum. Was soll man sagen? Ein manifester Aufstand der Dinge gegen das Schicksal, das ihnen der euklidische Raum aufnötigt.
Das „Diptychon“ könnte auch „Vertigo“ heißen. Denn es ist nichts weniger als Schwindel, Taumel, in den man da gerät. Was der Grund sein könnte, wird nicht verraten. Vielleicht ist es ja nur eine Spiegel-Laune. Aber auch dann wüsste man gerne, wo das mentale Epizentrum liegt, das die Bildgegenstände im Bildraum mit derartigen Energien versorgt. Energien, unter denen der konstruktive Halt, von dem Martin Kaspers Bilder stets in dem ihnen eigenen Rätselton berichtet haben, zu bersten droht. Irgendwie herrscht stiller Aufruhr. Nicht Splatter-Logik. So wenig wie früher der Halt soll jetzt der Zerfall bewiesen werden. Die Malerei will freier werden, so ist es. Sie will sich ihre Sensation nicht mehr in erster Linie von der Raum-Atmosphäre diktieren lassen. Inzwischen kann man auf diesen Bildern Partien entdecken, die sich in ihrem farbgestischen Duktus unübersehbar abgrenzen oder ausgrenzen und auch nicht mehr Bilder an der Wand, also bildinterne Bildgegenstände sind, sondern wie flächige Applikationen den verbliebenen Raumhintergründen eingeschrieben, eingemalt sind, ihnen innewohnen.
Der Maler hat die Tarkowski-Stimmung, die von seinen verlassenen Innenräumen ausgeht, nie abgestritten, aber mit nicht weniger Nachdruck hat er auf dem Primat bildnerischer Überlegungen beharrt. Und die Rolle des gegenständlichen Malers hat er nicht leugnen müssen, um deutlich zu machen, dass sie ihn nicht vollends ausfüllt. Es war immer riskant, wenn man Martin Kaspers Bildern allzu viel erzählerisch psychologische Raffinesse unterstellen wollte. Was Raffinesse an diesen Räumen ist, ist die Beziehung dysfunktionaler Formen, der untergründige Bezug formaler Elemente, die ihre Herkunft aus der dinglichen Welt nicht verschleiern, aber zur dinglichen Welt nichts wirklich beizutragen haben, die unzuständig scheinen für jeden plausiblen Kommentar. Aufs Ganze gesehen gibt sich der Maler auf eine sehr entschiedene Weise unentschieden: Er ist geradeso Bühnenbildner wie Formalist, dem die gegenständliche Welt immer auch Matrize farbkonstruktiver Systeme ist, die sich sorgsamer Planung und skrupulöser Entwürfe verdanken. Und wenn auch bei Martin Kasper die Regie des Unbewussten nie ganz auszuschließen ist, dann ist es ihm doch um Bilder zu tun, auf denen nichts der Laune überlassen bleibt, die vielmehr Stück um Stück gebaut sind und uns mit ihrer ausgeklügelten malerischen Organisation erreichen wollen.
Ganz verwunden hat es die avantgardistische Moderne ja nie, dass den Bildern die lästige Mimesis nicht vollends auszutreiben war, und die Gegenstände immer wieder triumphal zurückgekehrt sind. Dass der aufgeklärte Zeitgenosse polyglott zwischen den Kunstsprachen hin und her geschaltet hätte, zwischen Idee und Abbildung, Entfaltung und Darstellung, Erlösung von der Erzählung und Gebundenheit an die Form, es war immer nur eine freundliche Hoffnung. Tatsächlich ging es um Parteinahme und Widerstand, um Bewahren und Überwinden, um Anwaltschaft für die verlorene und Einsatz für die zukünftige Sache. Martin Kasper hält sich mit wunderbarer Unbeirrbarkeit aus der nie vollends abgeklungenen Polemik heraus. Das eigentümliche Kolorit seiner unbewohnten oder unbewohnbaren Räume, die abstrusen Widersprüche zwischen abgelebter Pracht und manifester Nutzlosigkeit, die Spannung aus Fülle und Nichtigkeit, die Waage zwischen den wahrscheinlichen und den unwahrscheinlichen Anteilen, die Suggestion der patinierten Leere, der Stillstand zwischen bildnerischer Gegenwart und Vergangenheit - das alles induziert eine existenzielle Mischung aus Gesehenem, Vermitteltem, Erinnertem und Erfundenem. Und angesichts des virtuosen Schwankens zwischen Capriccio und Vedute wäre es schon immer unsinnig gewesen, dieses Werk bloß als Beitrag zur Phantasiegeschichte des Interior Designs zu verstehen.
Wobei es keine Rolle spielt, woher die gegenständlichen Anregungen stammen. Der Maler kann dazu immer etwas sagen und macht aus der Herkunft seiner Impulse auch kein Geheimnis. Das Entscheidende aber ist doch, dass es Bilder sind, die er in seine Bilder einbezieht. Der Helm mit zugeklapptem Visier, der so mächtig die linke Bildhälfte bestimmt und mit seinen spiegelnden Krümmungen für die Torsionen der Raumarchitektur verantwortlich sein könnte, hängt nebenan als gemaltes Ungetüm an der Wand. Es ist - das wird gerade an dem neuen Zweiteiler erkenntlich - Malerei, die sich in erster Linie auf Malerei bezieht. Und dazu ist auch kein Widerspruch, dass an all den Kasper-Räumen Erlebnis und Anschauung geradeso zielführend mitgestaltet haben wie Gedächtnis und Gestimmtheit. Was zuletzt im Atelier geschieht, ist hoch reflektierter Ausgleich zwischen den bildnerischen Ideen und den bildnerischen Notwendigkeiten.
Nicht selten spielt auch eine auf ihre technische Wucht reduzierte Moderne mit, die sich nicht stört daran, dass ganz nachbarschaftlich Stuckleisten die Decke einfrieden und Protzlüster oder Beleuchtungskörper im Stalin-Pomp hängen. Alles gibt es eben: Die Diner-Unwirtlichkeit und das Konferenzzimmer der sechziger Jahre, den Festsaal à la Realsozialismus und die futuristische Kommandozentrale und das Kino ohne Programm, die Vorstadtbühne, auf der schon lange keine Heimattruppe mehr ihr Dorfpublikum empfing, und die seltsamen Kompartimente, die eine Bühnenbildnerin wie Anna Viebrock für eine Marthaler-Inszenierung entworfen haben könnte. Und wer will, darf angesichts des Verlassenheits- oder Aufgelassenheits-Charakters der Kasperschen Räume auch an Edward Hopper denken. Nur dass Hopper aus seinen atmosphärischen Motiven eine Art ikonischer US-Erzählung schafft, während Martin Kasper viel eher an den diffusen Eindrücken interessiert ist, am Verwirrspiel, an der Auflösung der vermeintlichen Einheitlichkeit, am Bau, der sich erst eigentlich beim Umbau bewährt.
Man kann in diesem Werk nicht von einem Bild aufs andere schließen. Das macht die Begegnung mit ihm so verblüffend und so spannend. Man könnte zwar längst mit Bestimmtheit von den Bildern auf ihren Autor schließen - das Bildklima ist unverwechselbar, und doch setzt sich der Film nicht einfach fort. Gerade jetzt, so scheint es, eilt er wieder einmal in einer überraschenden Wende auf und davon. In welche Richtung, wir werden sehen.
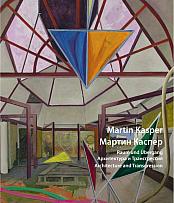
Martin Kasper, ›Architecture and Transgression‹, Text: Herbert M. Hurka, hrsg: modo-Verlag, Freiburg, 2017 http://muar.ru/en/exhibitions-events/exhibitions »
mehr»
mehr»
Katalog zur Ausstellung ›Architecture and Transgression‹ im Schusev State Museum of Architecture, Moskau vom 22. Juni bis 30. Juli 2017
Herbert M. Hurka Räume der Außenwelt und Innenwelt Zu Martin Kaspers Architekturmodellen
Öffentliche Räume sind anonym und auf bestimmte Zwecke hin geplant. So beleben sich Amtsgebäude, Theater, Ballsäle oder Schwimmbäder nur während ihrer Öffnungszeiten oder zu Veranstaltungen. In der übrigen Zeit sind sie menschenleer und nur sie selbst. Solche Raumansichten beschäftigen Martin Kasper seit nunmehr 15 Jahren. Vordergründig bestechen sie durch ihre einfühlsam ausgearbeiteten Interieurs, detailreichen Dekors und innenarchitektonischen Besonderheiten, auf einer subtextuellen Ebene allerdings sind die Raumfluchten, die hohen Decken und Glasfronten auf Kaspers Gemälden als ein Paradigma der Unbehaustheit zu lesen. Nachdem Kasper sich vor allem auf den früheren Bildern von Architekturstilen der 1950er und 60er angezogen fühlte, entwickelt sich seine Malerei inzwischen nach derselben Dynamik wie das unablässig sich wandelnde Erscheinungsbild der urbanen Lebensräume. Werke wie „Halbrund“ oder „Schwimmbad“ orientieren sich noch nahe an den empirischen Gebäuden, nach denen der Künstler jede Stadt, in der er sich aufhält, durchforscht. Fotografisch gesichert und danach skizziert, wird der eigentliche Malakt zur dritten Phase. Bis dahin verändert sich das Motiv buchstäblich unter der Hand. Hier etwas hinzugefügt, dort etwas weggelassen, die Fluchtlinien, Winkel, Bögen, Kurven, Lichteinfall und Proportionen manipuliert. Wirken diese Räume auf den ersten Blick noch realistisch, so teilt sich bei genauerem Hinsehen bald mit, dass ihre ursprüngliche Architektur und ihre Baugesetze sich zu Konstruktionen nach den Anforderungen der Malerei verfremdet haben, und die vielen unscheinbaren Verschiebungen zu einem artifiziellen Gefüge verschmelzen, durch das sich ein subjektives Raumkonzept zu erkennen gibt. Dass ein Raum niemals als Ganzes zu haben ist, sondern unsere Wahrnehmung die Räume fragmentiert, weshalb der eine, homogene optische Raum nicht mehr ist als eine Idealisierung und ein Phantasma – auch das zeigen diese Bilder. Aus diesem vakanten Zustand schält Kasper die Individualität einer Örtlichkeit heraus, um, wie er selbst sagt, Portraits von Räumen zu malen. Diese Bedeutungsübertragung erweist sich in jedem Fall als berechtigt, denn ein ernst zu nehmender Porträtist stellt von seinem Modell mehr dar als nur die sichtbare Oberfläche, denn ein Porträt sollte immer auch Charakterzüge freilegen. Seit Immanuel Kant den Raum als eine Form der Anschauung bestimmt hat, verlagern sich Raumwahrnehmung und -erfahrung ins Subjektive und sedimentieren sich, wie man inzwischen sagt, zu kognitiven Raumkonzepten. Einer Malerei, die davon handelt, eröffnet sich eine Vielfalt von Realisierungen. Allein in dem geometrischen Substrat aus Geraden, Winkeln und Bögen bietet sich eine unerschöpfliche Ressource für formale Evolutionen, so zum Beispiel auf „Macdo“ und „Pong 2“. Wenn Dreiecke sich als Farbflächen aus ihrer Umgebung lösen, Balken und Fensterstreben sich zu einem Netz graphischer Beziehungen verselbständigen oder rotierende Farbkreise ineinander spielen, dienen solche Formansätze viel weniger der Objektivierung eines verinnerlichten Raumkonzepts als dazu, bildimmanente Anlässe zu schaffen, das konventionelle Wahrnehmungsschema aus stabilen Parametern wie Böden, Wänden und Decken mit abstrakt-konstruktivistischen Formen zu konterkarieren. En passant lassen sich Leerstellen in der Innenarchitektur für Bilder im Bild nutzen. Der medienspezifischen Erweiterung des Kontextes entspricht die kunsthistorische mit dem zitierten „Cicada“ von Jasper Johns. Wenn Bildräume wie bei „Macdo“ und „Pong 2“ zu Bühnen für autonome Formen mutieren, ergeben sich daraus Variationsmöglichkeiten mit überraschenden Komplexitätsschüben. Was konstruiert ist, kann jederzeit auch dekonstruiert werden und wo wäre das Paradigma der Konstruktion evidenter als bei Bauwerken. Immerhin noch im Bereich eines real Vorfindbaren lassen sich die eingestürzten Bretterwände auf „Baracke“ ansehen. In der Zerstörtheit eines sich selbst überlassenen und der Erosion preisgegebenen Gebäudes, dessen ursprünglicher Zweck kaum mehr zu erkennen ist, verzerrt sich ein in Richtung Boden sinkendes Paneel zu einem absurden Fächer, während die verwitterten, einigermaßen aber noch intakten Wandverkleidungen in ihrem ehemaligen Parallelanordnung von der Decke nieder hängen. Was immer in diesem morbiden Szenario realistisch erscheinen mag, wird dementiert von der Farbgebung der offenen Landschaft im Hintergrund, der in einem so künstlichen Magenta aufgezogen ist, dass er nur mühsam an den zum Sujet passenden Sonnenuntergang erinnert. Gänzlich dekonstruiert und ins Unwirkliche verrückt, ist die Komposition eines Deckenrondells, das von einem Metallgerüst mit Bretterumläufen gestützt scheint – ein Bauwerk, das seinerseits von einer Landschaft eingekreist ist. Auch wenn der Titel „Panorama“ die optischen Verhältnisse klar stellen müsste, weil es sich dabei ursprünglich um eine Trompe-l’oeil-Malerei handelt, die als Rundbild eine aufs 18. Jahrhundert zurück gehende 3D-Illusion erzeugt, gelingt Martin Kasper das Kunststück, selbst diese optische Täuschung in eine Täuschung zweiten Grades aufzulösen. In diesem Raumspektakel fallen die Grenzen zwischen Innen und Außen erst bei einem genaueren Blick auf, so dass sich der abgründige Eindruck einer Traumszenerie aufdrängt, zu dem die abschüssigen Flächen eines Mittelsockels ihr Übriges beitragen. Solche Panorama-Bilder, die als ein früheres Massenmedium mit dem Aufstieg des Kinos zunächst in der Versenkung der Mediengeschichte verschwunden waren, erleben mit der Erfindung der japanischen „Sweep-Panorama“-Kameras eine unerwartete Renaissance und erreichen eine neue Popularität auch durch die Visualisierung digitaler Animationen auf Bildschirmen oder gekrümmten Projektionsflächen. Mit dem Bewusstsein für aktuelle Medienentwicklungen und visuelle High-Tech-Verfahren insistiert Martin Kasper auf dem nach wie vor resistenten Medium der Malerei und antwortet mit einer künstlerischen Virtuosität, die sich in elektronischen Verfahren kaum je mitteilen kann, weil eine unsichtbare Technik den menschlichen, das heißt insbesondere, den körperlichen Anteil der Produktion verdrängt. Auch wenn die Bildtitel „Istanbul“, „Athen“ oder „Sofia“ lauten, so weisen diese Motive aus einer weiteren Werkgruppe auf alles andere als auf touristische Impressionen hin. Im Gegenteil. Anstatt die genannten Städte durch Sehenswürdigkeiten oder anders Typisches im Stil einer traditionellen Reisemalerei sinnlich erfahrbar zu machen, kommentiert Kasper – durchaus mit einem Schuss Sarkasmus – das abgerissene Ambiente heutiger Metropolen. Was auf diesen Städtebildern abgebildet ist, verdient weder einen Namen noch einen Hinweis auf die Herkunft: Aufgegebene Orte, kaputte Gebäude wie Lagerräume, aufgelassene Depots und, nicht zufällig unter der Erde, eine Unterführung wie auf dem merkwürdig roten „Sofia“. Dabei wird das hier zurückgenommene Farbspektrum durch differenzierte Lichteffekte kompensiert, während die graphischen und kompositorischen Elemente aus düsteren Betonbrocken („Sofia“) oder von irgendwo hereinragenden Metallstreben sowie die Reste einer Klimaanlage („Athen“) die inhumane Atmosphäre steigern. Ließen sich die Offizialräume der früheren Bilder noch als menschenleere Nicht-Orte im Sinn des französischen Soziologen Marc Augé interpretieren, der Einkaufszentren, Bahnhöfe und Hallenbäder aufgrund ihrer Monofunktionalität und Geschichtslosigkeit von den Wohnstätten unterschied, so wählt Martin Kasper für diese Werkgruppe explizit menschenfeindliche Plätze aus, wobei die technische Ausführung sich den Motiven anpasst. Anstatt jenes feinen Pinselduktus, der jene Bilder kennzeichnete, dominieren nun großzügige Spachteltexturen. Deren gerissene Flächen gleichen sich den thematisierten Betonflächen an, genau wie die harten Kanten den Bruchstellen einer übel ramponierten Bausubstanz entsprechen. Die Rohheit der Sujets schlägt sich in der Rohheit der künstlerischen Form nieder. Oben – unten, vorn – hinten, rechts – links: Diese Adverbien bezeichnen die Raumkoordinaten, in denen das Subjekt sich mit Bewegungsapparat und Sinnesorganen orientiert. Auch Martin Kaspers Bilder folgen einem Orientierungssystem – der Zentralperspektive. Obwohl eine erlernte Kulturtechnik, ist uns die räumliche Wahrnehmung per Zentralperspektive längst zur zweiten Natur geworden. Gleichzeitig strukturieren die verinnerlichten Raumdaten auch die Psyche, so dass Innen- und Außenwelt sich stets überschneiden und zu einem mitunter unauflösbaren Realitätsempfinden führen, das gerade ein Motiv wie „Panorama“ exemplarisch visualisiert. Darüber hinaus sind diese Bedingungen von einer anthropologischen Tiefenstruktur unterfüttert, die in der naturgegebenen Schutzlosigkeit des menschlichen Körpers begründet ist. Seit der Homo sapiens den Schutz der Höhlen hinter sich ließ und begann, sich eine wehrhafte Schutzhülle, ja Panzerung aus allen möglichen Baumaterialien zu schaffen, beschäftigen ihn die Phänomene Bauen und Gebäude. Antike Mythen wie vom Turmbau zu Babel oder dem kretischen Labyrinth bezeugen das ebenso wie die philosophischen Grübeleien Gaston Bachelards, der in dem Buch „Poesie des Raums“ die Phänomenologie des Hauses ergründet. Freud geht darin noch weiter, wenn er das Subjekt nach der Metapher des Hauses aufteilt, wonach der Keller das Unbewusste, die Beletage das Ich und das Dachgeschoß das Überich symbolisieren. So ist es keineswegs Zufall, wenn sich am Bild des Hauses die Grenzen zwischen konkreter Wahrnehmung und Projektion auflösen und einen Zustand der Inkonsistenz herbeiführen, der Phantasien provoziert. Von Piranesi bis Paul Delvaux, De Chirico bis M.C. Escher und Anselm Kiefer überraschen Künstler immer wieder aufs Neue mit nie vermuteten Raumphantasien. Das lässt sich ohne Einschränkung auch von Martin Kasper behaupten, der es sicher nicht ablehnen wird, sich in diese Tradition eingefügt zu finden.

Bruchstücke/Spiegelfragmente, Hrsg: Velten Wagner, Texr: Martin Kasper und Velten Wagner, 2016
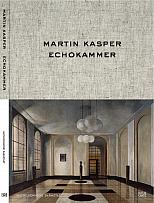
Martin Kasper, ›Echokammer‹, Hrsg: Ralf Beil, Text: W.G.Sebald, Inger Christensen, Ralf Beil http://www.hatjecantz.de »
mehr»
mehr»
Atelier-, Architektur- und Figurenporträts: Resonanzräume menschlichen Seelenlebens
Martin Kasper (*1962 in Schramberg) verwandelt architektonische Räume durch seine Temperagemälde in Schauplätze seelischer Befindlichkeit: Es entstehen Orte der Leere, gedankliche Freiräume, Momente gespannter Ruhe und Atmosphären von eigenwilliger Aura. Die neuen Ganzfigurenporträts des Künstlers, in denen die Dargestellten vor den Hintergründen zu schweben scheinen, erweitern die Architekturbilder eindrucksvoll. Die historischen Bildhauerateliers des Museums Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe Darmstadt inspirierten Kasper zu einer Malerei-Installation, die Architektur- und Menschenbilder im gegenseitigen Echo vereint und zugleich den realen mit dem imaginären Kunstraum verschränkt. Der Band dokumentiert die Ausstellung anhand von In-situ-Aufnahmen und bietet so einen lebendigen Einblick in das Gesamtwerk des Künstlers, dessen geheimnisvolle Innenwelten in literarischen Texten, etwa von Inger Christensen und W.G. Sebald, ein weiteres Echo finden. Ausstellung: Museum Künstlerkolonie, Mathildenhöhe Darmstadt 2.2.–21.4.2014
IM LABYRINTH DER STILLE Ralf Beil
„Wenn wir das Labyrinth nicht finden konnten, sagte Sam und sah tiefsinnig aus, dann deshalb, weil es nie gefunden werden kann, weil es sich nicht in Clusium oder anderswo findet, sondern sich überall findet, so dass wir immer im Labyrinth drinnen sind und eigentlich größeren Grund haben sollten zu glauben, dass wir es finden können, als wir selber ahnen, aber es geschieht nie, denn mit jedem Schritt, den wir tun, bewegt das Labyrinth sich mit uns zusammen, in genau derselben Geschwindigkeit und Richtung wie wir selber.“ Inger Christensen, Das gemalte Zimmer
Vom Mehrwert der „wahren Lüge“
Seit Jahrtausenden malen Menschen Figuren und Räume auf Wände aller Art. Seit Jahrhunderten malen Künstler Figuren und Räume auf Holztafeln und Leinwände. Seit dreißig Jahren malt Martin Kasper Architekturen, Räume und nun auch Figuren auf mittelgrobes Leinen. Warum? Die leichte Variation eines Satzes des Kulturkritikers Dietmar Dath gibt einen ersten Hinweis: „Literatur [lies: Malerei] darf sich von der Informationsflut [lies: Bilderflut] nicht einschüchtern lassen, sie kann sie auch nicht eindämmen – sie muss damit arbeiten, damit lügen und die Wahrheit sagen.“ Auch Martin Kasper „lügt“ – und zwar auf virtuose Weise. Seine gegenständliche Malerei eröffnet uns Bildräume, die es so nicht gibt, auch wenn es oft den Anschein haben mag und wir sie mitunter sogar zu kennen glauben. Die Fotos, die der Maler verwendet, bilden nur die Grundlage seiner seltsam spannungsgeladenen Architekturbilder. Und selbst wenn seine Ganzfigurenporträts in direkter Konfrontation mit dem Modell im Atelier entstehen, so werden sie am Ende in imaginären Räumen platziert, die fast ausnahmslos Kaspers eigener Bildwelt entstammen. Wie ist es nun um die „Wahrheit“ dieser Malerei bestellt? Da scheint zuallererst die elementare Wahrheit des Materials und Arbeitsprozesses als manifestes und greifbares Diesseits jenseits digitaler Clouds auf. Unbeeindruckt von den Bild-Tsunamis und Multimedia-Anwendungen unserer Tage grundiert Martin Kasper seine Leinwände mit durchsichtigem Hasenhautleim, einer bereits seit dem Mittelalter bekannten Vorleimung. Er vermengt wasserlösliche Pigmente mit eben diesem transparenten Leim für den Erstauftrag, und malt dann Schicht um Schicht mit lasierenden Eitempera-Emulsionen aus Öl, Wasser, Ei und Pigmentpulver. Wie bei der Entstehung von Literatur findet eine künstlerische Verdichtung bereits durch die intensive Bearbeitung statt, die zu einer ganz eigenen Vielschichtigkeit und Farbintensität seiner Malerei führt. Zugleich bleibt die Struktur der Leinwand, des Bild- und Farbträgers, immer sichtbar. Spürbar wird ferner die elementare Wahrheit der Sujets jenseits von Neutralität und Objektivität: Kaspers Schauplätze sind stets schon Weltinnenräume, seine Figuren frontale Emanationen: Hier geht es nicht um funktionale Benutzeroberflächen. Martin Kaspers „wahre Lügen“ laden qua ihrer genuinen Lesbarkeit, ihrer gegenständlichen Bildinhalte geradezu zur Interpretation der Räume und Figuren ein – zuallererst jedoch sind sie das Ereignis von Farbe.
Malerei mit Nachhall
Zu den „wahren Lügen“ der Gemälde Martin Kaspers gehört, dass sie Klänge und Geräusche in der Großhirnrinde provozieren können, ohne als reale Klangkörper auf das Trommelfell einzuwirken. Sie reagieren wie Echokammern, in denen im Gegensatz zum schallgedämpften Tonstudio der Nachhall, der durch Reflexionen an Raumoberflächen entsteht, verstärkt wird. Der dort künstlich erzeugte Halleffekt ist bei Martin Kasper ein künstlerisch erzeugter. Wie in der Musik wird auch in Kaspers Malerei der Nachhall insbesondere in Treppenhäuser, Fluren oder weiten Raumfluchten erzeugt. Seine Architekturbilder sind Echokammern im Wortsinn. Sie rufen insbesondere meist überhörte Klänge der Stille in unser Bewusstsein: das helle Sirren der Neonröhren im „Flur“, das dunkle Knarzen einer Flügeltür in „Warten“, den stummen Ghettoblaster und die dafür umso deutlicher wahrnehmbaren Geräusche der Straße, die durch das offene „Atelier“-Fenster dringen. Es scheint, als stelle Martin Kasper seine Räume gezielt still, damit wir ihrer je eigenen Atmosphäre und ihren suggestiven Schwingungen gewahr werden können. Bei aller Abwesenheit von Menschen in diesen Bildern wird immer wieder latente Anwesenheit signalisiert. Davon zeugt neben den zahlreichen Gemälden mit Körper-Stellvertretern wie Stühlen, Bänken, Säulen, Pfeilern, Treppen, Leuchten und Skulpturen insbesondere Martin Kaspers „Atelier“-Triptychon. Dort trifft die leere Körperhülle eines Schlafsacks auf den Körperschemen des Malers im Bild sowie auf gigantisch vergrößerte Ansichten eines Körperinnenraums. Das Selbstporträt wie auch die farblich verfremdeten Computertomografien des Künstlers existieren nur als Bild im Bild – als Paradox „ungemalter“ Bilder. Wie seine assoziationsreichen Gemälde wird auch Martin Kaspers Ausstellung insgesamt zur Echokammer – diesmal im übertragenen Sinn: Verstärkt, verdichtet und überlagert das Echo, die Extremform des Nachhalls, die Ursprungstöne, so verstärken, verdichten und überlagern sich bei Kasper die einzelnen Bilder gegenseitig in einer komplexen Malerei-Installation. Architekturbilder finden sich fragmentiert als Bildhintergründe der Portraits wieder, Bilder spiegeln sich immer aufs Neue in Bildern. So wie „Monde I“ hinter dem Selbstporträt des Künstlers im „Atelier“ aufscheint, so tauchen das „Atelier“, „Invasion“ und „Grüner Saal“ im eigens für die Bildhauerateliers gemalten „Echo“ auf. Nicht nur hier wird neben real existierenden Gemälden der reale Museumsraum irritierend ins Spiel der Spiegelungen eingebunden: Der Balken im „Atelier“-Bild von Martin Kasper findet sein reales Echo in den Stahlträgern der Bildhauerateliers. Das Ganzfigurenportrait von „Daniele“ reflektiert den Treppenflur zu den Atelierräumen so wie „Milena + Milou“ das Foyer des Museums Künstlerkolonie. Das „Echo“-Bild – selbstreflexives Echo der Ausstellung „Echokammer“ – verdoppelt seine Wirkung noch durch die Spiegelung von Bildern und Raum im glänzend gemalten Stirnholzparkett. Wie einst schon die Namen gebende Nymphe Echo im griechischen Mythos gibt Martin Kaspers „Echokammer“ dabei stets nur Bruchstücke, Brechungen, Teilelemente und Spiegelfragmente wieder – nie die ganze Geschichte.
Beseelte Architektur
Nicht nur die „Echokammer“ als Ganzes und die einzelnen Architekturbilder, auch Kaspers Porträts sind markant in ihrem Verzicht auf eine lesbare Erzählung. Das leichte Schweben der Figuren auf der Leinwand im Bild bewirkt die sanfte Ablösung des Menschenwesens vom ihm umgebenden Raum, der de facto erst nach dem Porträt malerisch in Erscheinung tritt: Die Figuren entstehen auf der leeren, lediglich grundierten Leinwand. Im Gegensatz zu religiösen Elevationen in der Tradition der Malerei – Christi oder Mariae Himmelfahrt – sind es bei Martin Kasper ihm nahe stehende Menschen, Verwandte und Freunde aus seinem engeren Lebensumkreis, die jenseits von Bodenhaftung seltsam eingebunden scheinen. Die gemalten Architekturen, die Kaspers Ateliermodelle umgeben, sind zumeist Fluchten im perspektivischen wie metaphorischen Sinn. Die Figuren bilden dazu einen Gegenpol. Sie holen das Bildgeschehen nahe heran, entwickeln aber mit ihrem ruhigen Stehen und ihrem oft lakonischen Blick bei aller Selbstgewissheit keine äußere Aktivität. Wäre Aktion zu beschreiben, so die Aktion „einer undeutlichen inneren Bewegung“ (W.G. Sebald), eine Aktion wartenden Innehaltens und angehaltener Spannung. Mit der Zusammenschau der Einzelporträts seiner Angehörigen und (Künstler)freunde entsteht eine imaginäre Bildfamilie wie einst in Mantegnas „Camera degli Sposi“ in Mantua, die Inger Christensen in ihrem „Gemalten Zimmer“ literarisch umkreist. Bei allen strukturellen Unterschieden über die Jahrhunderte hinweg geht es hier wie dort um beseelte Architektur in wandfüllender Malerei. Die „Echokammer“ von Martin Kasper präsentiert – ob in den Architekturbilder oder den Porträts – Weltinnenräume. Der Begriff der Kammer kommt nicht umsonst vom lateinischen camera: Martin Kaspers Bilder scheinen nachgerade eine Camera lucida zur Erhellung unserer Wahrnehmung dieser besonderen Orte. Um Martin Kaspers „Echokammer“ gibt es das Museum, dann die Stadt, dann das Land, dann die Welt – aber um all dies gibt es das Labyrinth der Stille, das in immer neuen Fragmenten in der Malerei des Künstlers aufscheint. Wir sehen Pigmente. Wir hören verhaltene, umso eindringlichere Klänge und Geräusche. Wir spüren Enge, Weite, Nähe, Leere, Resonanz und Spannung. Elementare Bodenhaftung und subtile Elevation.
„Früher träumte ich insgeheim davon, ich könnte einmal alles zusammenfügen, einen Schlussstrich ziehen unter alles. Um am Ende sagen zu können: so war es, so ging es zu, dies ist die ganze Geschichte. Doch das wäre wider besseres Wissen. Wider besseres Wissen ist andererseits eine gute Art, nicht aufzugeben. Wüssten wir es besser, gäben wir auf.“ Per Olov Enquist, Ein anderes Leben

Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Hrsg: ZEIT Kunstverlag, 2009
mehr»
mehr»
Am Bühnenrand
Hans-Joachim Müller
Am Meer, in der Wüste vielleicht, unter der Weite des Wolkenhimmels verfiele niemand auf die Idee, dass hier der Mensch fehlen könnte. Unendliche Räume sind unbewohnbare Räume. Um wohnen zu können, braucht der Mensch Dach und Wände. Und das Gefühl der Unendlichkeit ist nur ein anderes Wort für den Schauder vor der Dach- und Wandlosigkeit des Daseins. Ein Schauder aber, nichts weniger, wenn Dach und Wände von menschengemäßer Wohnbarkeit zeugen, und doch kein Mensch da ist, der in den Wohnungen wohnen wollte.
Man betritt die Bildwelt, in die Martin Kasper führt, nicht ohne jenen leisen Schauder, der sich immer dann ins Staunen mischt, wenn die Bewohnbarkeit von Räumen nicht ganz gewiss scheint und immer ungewisser wird, je deutlicher sich die feinen Risse zeigen, die die Wohlordnung von Dächern, Wänden, Böden durchziehen. Was ist nur im Ballsaal (Abb. 9) los? Die Schmuckleiste unter der Kassettendecke bricht plötzlich ab. Ein Lichtkeil unerklärter Herkunft hat die Stuckteile geschluckt. Die sphingische Form über der Treppe könnte ein Wandbild sein, könnte aber auch zur Architektur des Raumes gehören. In der Wandnische stehen die gestapelten Stühle auf einer von feinen Linien angedeuteten Plattform, die über dem Boden schwebt. Und keiner da. Bar, ausgeräumt. Der letzte Tanz muss lange her sein.1
Offenheit?Es gibt wenige Werke, die sich derart betreten lassen. Anders als in Form des Eintritts oder Zutritts findet die Begegnung mit Martin Kaspers in rund einem Jahrzehnt entstandenen Bildern nicht statt. Als stünde man am unsichtbaren Rand der Räume, an einer Türe oder einem Fenster im Vordergrund und blickte von dort hinein, hinein in seltsame Interieurs – und wüsste nicht, was das Seltsame in Wahrheit ist, irgendetwas, was auf den ersten Blick beruhigend stimmig erscheint und auf den zweiten beunruhigend unstimmig, gefährdet in Halt und Haltung. Stabil und stark, so muten Wände, Decken, Böden an. Nicht wie Kartenhäuser. Aber dann auch wieder wie Kulissen, leicht verschiebbar, auswechselbar und ganz und gar nicht erdbebensicher. Es ist da etwas, was einen bei aller Suggestion zugleich auf Abstand hält. Dass man wirklich drin wäre in den Räumen, sich innen wähnte oder fühlte, kommt kaum einmal vor. Und nie ist es so, dass man wie in einer virtuellen Architektur spazieren gehen, die Perspektive wechseln, die rätselhaften Details in der Nahsicht besser verstehen könnte. Der Beobachterort ist fixiert. Der Beobachterort ist draußen, gegenüber. Wie man einer Kinoleinwand gegenüber ist oder dem Bühnengeschehen vom Parkett aus zusieht. Tatsächlich tun sich Martin Kaspers Räume wie Bühnenaufbauten in kaum gebrochener Frontalität vor einem auf. Die Seiteneinblicke sind so selten2 wie die Verrückungen der zentralperspektivischen Anlage3. Immer sitzt man angesichts dieser Bilder wie auf einem festen Abonnementsplatz. Man wird nicht mal an die Seite, mal auf den Rang, mal in die Loge gebeten. Der Maler malt, wie einer mit starrer Kamera fotografiert.
Und wenn es im Werküberblick auch unzulässig wäre, von einer strengen Bildregel zu sprechen, so gilt doch, dass die Fluchtlinien meist auf der horizontalen Bildmitte auftreffen – oder nur wenig darüber oder darunter. Decke und Boden beanspruchen häufig gleich viel Fläche, man könnte auch sagen, sie verhalten sich auf eine Art spiegelbildlich zueinander. Wenn man sie austauschen würde, die Bilder gleichsam auf den Kopf stellte, würde sich, was die Raumweite und Raumdichte angeht, nicht viel ändern. Auch so behielte der unter Teil seine Eignung als Postament, als tragender, präsentierender Grund, und der obere Teil seine eigentümlich lastende Wucht.
Verschlossenheit?Das fällt an nicht wenigen dieser Räume auf, wie sie nach oben hin nicht einfach abgeschlossen, sondern regelrecht versiegelt wirken, wie die Decken mit ihren Kassetten, Vorsprüngen, Schmuckleisten, gestuften Unterbauten, überwölbenden Risaliten, umlaufenden Bändern und schweren Beleuchtungskörpern wie Grabplatten auf den Sälen liegen. Es sind keine Dächer zum Unterstehen, keine Stationen, wo man eine Weile warten würde, um in Eile weiter zu kommen. Nirgendwo geht es weiter. Und wenn Treppen oder Türen im Hintergrund verborgene Räume anzudeuten scheinen4, dann sind das keine Fluchtwege. Der Blick ist gefangen. Und nichts außerhalb, was von Belang wäre. Das ist ganz entscheidend in diesem Werk. Martin Kasper interessiert sich nicht für Raumsysteme oder reproduzierbare Raumtypen, nicht für wuchernde Architekturen, nicht für weißwandige Neutralität. Im White Cube hält sich der Maler nicht auf, und unter bauhäuslerischen Rationalisten wird er keine Freunde finden. Was er malt, sind Orte, begrenzte, bezeichnete, charakterisierte Orte.
Gemalte Orte, keine Orte, die die unbestechliche Kamera festgehalten hätte. Auch wenn den Bildern Entdeckungen und Erlebnisse vorausgegangen, wenn sie aus fotografischer Sammelarbeit entstanden sind, fehlt ihnen doch alles zum Dokument. Was beim Malen geschieht, ist ein komplexer Bewusstseinsprozess, den es gründlich zu bedenken gilt. Vorerst mag es genügen, wenn wir sagen, dass dieses Malen nicht auf Abbildung tendiert, sich nicht in der getreulichen Vedute erfüllt, dass es vor aller Ortsschilderung oder Ortsbeschreibung erst einmal an der gegenständlich konstruktiven, auf eine Art auch baumeisterlichen Tatsache des Bildes selber interessiert ist. Ein Bild wie Langer Flur (2007) zeigt exakt, was es verspricht. Einen langen Flur, wie es Flure auf Ämtern und Krankenstationen gibt. Eine Sitzbank, links und rechts Türen, Deckenleuchten in einer Reihe. Nichts, was es erst zu deuten, zu übersetzen, aus hermetischem Zeichenmaterial aufzuschließen gälte. Man darf den Bildtitel also getrost wörtlich nehmen, man verpasst nichts, wenn man vor dem Bild so handelt, wie man vor einem langen Flur handeln würde – wenn man das Auge den langen Flur entlang sehen lässt, immer den architektonisch festgelegten Blickschienen entlang, bis es ganz hinten, am Flurende angekommen ist. Dieses Sehstrecken-Ende ist als schwarzes Feld ausgebildet. Es liegt nur wenig unterhalb des Bildmittelpunkts und markiert eine mächtig saugende Sog-Stelle. Dort, an der mächtig saugenden Sogstelle, ist die Ämter- und Krankenstationen-Anmutung jäh verschwunden. Angekommen am Kreuzungspunkt von vier Lichtbahnen, die das Bild in vier gleich große Kompartimente teilt, hat man alle räumliche Illusion verloren. Das Bild kippt aus der Architektur in bildplane Geometrie, zerfällt gleichsam in seine konstruktiven Bestandteile.
Baupläne?Indes scheint das Geheimnis des Langen Flurs nicht schon verraten, wenn man seine Maße nachgemessen hat. Das Werk verführt zur Erzählung, lässt Messen und Nachmessen nicht lange zu. Irgendeine geheime Narration muss diesen menschenleeren Räumen5 doch eingeschrieben sein. Auch scheint es immer wieder um das gleiche oder ähnliche Stück zu gehen, das auf diesen leeren, entleerten Raumbühnen spielt. Ein Stück eben, das man nicht kennt und doch zu ahnen meint. Ein Einpersonenstück, ein Mehrpersonenstück, wer weiß. Und doch ist Vorsicht angeraten. Wer allzu schnell die Geschichte sucht, übersieht die malerischen Baupläne. Martin Kaspers Räume sind sorgsam geplant, entworfen, Stück um Stück gebaut, nicht aus poetischer Laune geworden. Und immer hat die präzise Struktur, das kontrollierte Zusammenspiel der Flächen, Bänder und Kuben Vorrang vor dem Storyboard. Das unterscheidet das Werk deutlich vom neosurrealen Zeitgeist. Es ist nicht die Regie des Unbewussten, die hier Architekt oder Inneneinrichter spielt. Die Bilder wollen Bilder sein, die als Bilder funktionieren und nicht zuletzt mit ihrer ausgeklügelten malerischen Organisation Interesse wecken.
Andererseits möchte man den Reim dann doch gerne kennen, den man sich auf die aufgehängten Balken und Bretter im grün gekachelten Saal mit Oberlicht machen soll. Woran soll man denken? An ein Tiergehege? An das Affenhaus im Zoo? Cube, der Bildtitel6, leistet wenig Hilfe. Cube, so scheint es, ist reine Verlegenheit. Wie es reine Verlegenheit wäre, wenn man den Langen Flur auf das Lichtkreuz reduzieren würde. Es ist schon richtig, auf der bedachten Gemachtheit dieser Bilder, auf ihrer eigensinnigen Künstlichkeit zu beharren. Und doch wird man den langen Flur abgehen müssen und wird das nicht ohne die Bange tun können, die einen stets auf langen Fluren begleitet. Die Augen sehen, und die Augen empfinden, und man kann auf dem langen Flur das Sehen und Empfinden nicht eigentlich auseinander halten. Und wer dabei an Kafkas Herrn K. denkt, wie er am Sonntagmorgen das Haus sucht, in dem sein Prozess stattfinden soll, wie er die abgelegene Juliusstraße entlang läuft „tiefer in die Gasse hinein, langsam, als hätte er nun schon Zeit oder als sähe ihn der Untersuchungsrichter aus irgendeinem Fenster und wisse also, dass sich K. eingefunden habe“7, der hat sich keiner unerlaubten Assoziation schuldig gemacht.
Attraktion?Es ist der nämliche Drive, der Kafkas schuldig Unschuldigen durch gespenstische Treppenhäuser in leere Verhörzimmer lenkt und einen mit Macht auf die Bühnen zieht, auf denen Martin Kasper seine magischen Raumbilder aufgebaut hat. Auch im malerischen Werk gibt es ein Verhörzimmer8. Heizkörper, Dielenbretter, alter Polstersessel, Wasserrohr an der Decke, Spiegelfenster mit Blick auf den Vernehmungstisch. Wie dicke Stoffbahnen überziehen die olivgrün braunen Farben Wände, Decke und Boden und machen die Zelle stumpf, als sollte sie schalltot sein. Was sollte uns hindern, den Langen Flur und das Verhörzimmer zusammen zu sehen? Was spräche dagegen, die Bilder zur verschwiegenen Geschichte zu verknüpfen und noch einmal Herrn K. zu folgen, wie er am nächsten Sonntag wieder auf Prozessraum-Suche ging: „… geradewegs über Treppen und Gänge; einige Leute, die sich seiner erinnerten, grüßten ihn an ihren Türen, aber er musste niemanden mehr fragen und kam bald zu der richtigen Tür. Auf sein Klopfen wurde ihm gleich aufgemacht, und ohne sich weiter nach der bekannten Frau umzusehen, die bei der Tür stehenblieb, wollte er gleich ins Nebenzimmer. ‚Heute ist keine Sitzung‘, sagte die Frau. ‚Warum sollte keine Sitzung sein?‘ fragte er und wollte es nicht glauben. Aber die Frau überzeugte ihn, indem sie die Tür des Nebenzimmers öffnete. Es war wirklich leer und sah in seiner Leere noch kläglicher aus als am letzten Sonntag. Auf dem Tisch, der unverändert auf dem Podium stand, lagen einige Bücher. ‚Kann ich mir die Bücher anschauen?‘ fragte K., nicht aus besonderer Neugierde, sondern nur, um nicht vollständig nutzlos hier gewesen zu sein. ‚Nein‘, sagte die Frau und schloss wieder die Tür, ‚das ist nicht erlaubt. Die Bücher gehören dem Untersuchungsrichter.‘ ‚Ach so‘, sagte K. und nickte, ‚die Bücher sind wohl Gesetzbücher und es gehört zu der Art dieses Gerichtswesens, dass man nicht nur unschuldig, sondern auch unwissend verurteilt wird.‘ ‚Es wird so sein‘, sagte die Frau, die ihn nicht genau verstanden hatte.“9
Freilich ist es nicht so sehr die wahnhafte Schuld-Unschuld-Verstrickung, aus der die Parallele stammt. Wohl ist es wahr, dass sich der Maler mit sichtbarer Vorliebe in Räumen nicht ganz zweifelsfreier Bestimmung aufhält. Wie Edward Hopper mit seinen einsamen Tankstellen, Bars, Bungalows eine Szenografie geschaffen hat, die sich über die Neuengland-Romantik hinaus unschwer als illustrative Grundierung einer modernen „condition humaine“ lesen lässt, gehören auch die Kulissenteile, die Martin Kasper auswählt und anpasst, zur Bühneneinrichtung einer zeitgenössischen Dramaturgie. Nur ist sein Stück kein moralisches Stück und keines, das von der Dynamik untergründiger Energien und Obsessionen handelte. Aus den Foyers, Wartehallen, Observationsräumen, U-Bahn-Stationen, Flughafen-Entrees und aufgelassenen Festsälen im Stile altsozialistischer Repräsentation wird kein politisches Programm. 10
Zwar ist mit der Einladung in solche Bildräume nicht gerade Aufgehobenheit versprochen, gar angenehmes Unterkommen, Behüttung oder Behütung. Kalt erscheinen die Interieurs. Immer herrscht dieses kranke Licht, die labortechnische Ordnung, die Asepsis der Pathologie. Zum Wohlfühlen ist das wahrlich nicht. Aber als Metapher für die Unbehaustheit des Menschen wären die Ingredienzien der befremdlichen, der abstoßenden Anmutung gänzlich missverstanden. Abstoßung findet ja auch nicht statt. Was Martin Kaspers Bildorte mit dem Ambiente verbindet, in das Kafkas K. gerät, ist nichts weniger als eben dieses Hineingeraten, die kolossale, ganz und gar erstaunliche Anziehungskraft, die von ihnen ausgeht. Das Gericht werde von der Schuld angezogen, erklärt sich der Protagonist im Roman die eigentümliche Selbstbeobachtung, dass er auch ohne Wegleitung an den Verhandlungsort findet, dass es ihn gleichsam hintreibt, wo sein Prozess stattfinden soll. Nicht anders ergeht es einem vor Martin Kaspers Bildern, wo man zur Erklärung der unwiderstehlichen Attraktion keinen moralischen Wirkmechanismus braucht, wo alle Erfahrung in der sinnlichen Gewissheit zusammen schießt, dass es nur die Leere sein kann, die Entleertheit der Räume, die einen aufsaugt, die einen schluckt wie ein schwarzes Loch.
Leere?Bilder an der Wand, wir sind im Museum, kein Zweifel. Die runde Besucherbank, wie man sie vom Kunsthistorischen Museum in Wien her kennt, hat dem Bild seinen Namen gegeben: Space shuttle, 2009 (Abb. 7 u. 5). Aber niemand, der auf die Bilder achten würde. Niemand, der auf der Rundbank Platz genommen hätte. Und an den Wänden auch kein Tizian und kein Parmigianino, nur Bilder von leeren Museumsräumen mit und ohne Rundbänken. Als spiegelte sich das Bild im Bild, der Raum im Raum, die Leere in der Leere. Ist es dieser Zirkelschluss, das undurchdringliche Verweisnetz, das niemanden da sein lässt, den Aufenthalt hier unmöglich macht?
Auf anderen Bildern11 erinnert das Dekor an Weltenschöpfungen à la Hollywood. Aus welchen Filmen stammt, was da im fahlen Großlicht wie Hauptquartier, Kommandobrücke, Kontrollstation, Steuereinheit oder Rechenlabor anmutet? Die Stimmung schwankt zwischen Raumschiff Enterprise und Weltvernichtungssalon à la Dr. No. Aber wer da was lenkt und leitet und Rettung oder Untergang beschließt, das wird nicht verraten. Keiner, der Verantwortung übernehmen wollte, kein einsamer Held bei seiner „Mission impossible“.
Oder diese Festsäle – Doppelhelix, 2009 (Abb. 6), Lviv II, 2009 (Abb. 2) – mit ihren euterschweren Lüstern, die einmal erstrahlten, als unter ihnen verdiente Werktätige zu Helden der Arbeit geadelt wurden. Längst ist das Licht aus, die Sicherung herausgeschraubt. Der Boden glänzt, als hätten sich keine Putzkolonnen, sondern Restauratoren über ihn hergemacht. Gelassen wartet der Stuhl an der Wand darauf, dass er noch einmal für Ordens- und Ehrensachen gebraucht würde. Aber nie beginnt die Weltgeschichte von Neuem, nie wiederholt sich etwas. Leere Räume sind wie Fermaten im Fluss der Zeit. Etwas ist stehengeblieben, angehalten worden, nutzlos geworden. Für nichts und niemanden gut. Menschen wären Garanten für Leben, für Zeit, für Geschichte. Wo Restauratoren den Boden versiegelt haben, rechnet keiner mehr mit Leben, Zeit, Geschichte. Der Anhalt und die Leere berühren sich auf Martin Kaspers Bildern wie zwei, die sich vorsichtig an den Händen halten.
Anhalt?Anhalt und Leere wie im Wartesaal. Ein Raum, wo man wartet, dass es Zeit wird. Wo alle warten, sind alle Opfer der vielen, der zäh vergehenden Zeit. Wo alle warten, sind auch alle Opfer der vielen, der zäh hängenden Blicke. Warteopfer sind Blickopfer. Jeder schaut dem anderen beim Warten zu, jeder schaut zu, wie ihm beim Warten zugeschaut wird. Das ist ein wenig peinlich. Und peinlich ist, wie die Opfergemeinschaft erträgt, dass die Intimität des Wartens öffentlich geschieht. Was aber, wenn die Opfergemeinschaft fehlt, wenn auf Martin Kaspers Bild der „Wartesaal“ leer bleibt? Dann ist die Leerstelle wie ein Magnet, in dessen Kraftfeld man gleichsam körperhaft spürt, wie es wäre, wenn man da säße und eben nicht allein da sässe. Ein Wartesaal-Bild mit Wartenden würde davon handeln, was ungemütlich ist an Raum und Zeit. Das Wartesaal-Bild ohne Wartende handelt von Anhalt und Leere, von der Faszination an leerem Raum und leerer Zeit.
Martin Kaspers Räume kennzeichnet eine eigentümliche Mischung aus Vertrautheit und Künstlichkeit. Man könnte jedes Detail exakt beschreiben, aber man weiss nie exakt, wo man sich befindet und was hier geschehen ist oder geschehen könnte. Schicht um Schicht haben sich im malerischen Prozess Einfälle, Erfindungen, Verwerfungen und Revisionen über den realen Prospekt gelegt. Es ist ein Malen, das sich selber als etwas erfährt, das aus der Erinnerung aufsteigt. Das bestimmende Klima der Räume ist immer das der Erinnerung. Und im Klima der Erinnerung überblenden sich die abgebildeten und die erlebten, die fotografierten und die besuchten Räume. Als erinnerte Räume sind die Räume konstruierte Räume, keine rekonstruierten Räume. Es sind utopische Räume, Räume voller Überschuss an Behauptung. Räume, wie sie ein Filmausstatter entwerfen könnte, der zugleich sein eigener Stückeschreiber, Regisseur und Hauptdarsteller ist. In einem eindrücklichen Bilanzbild hat Martin Kasper das eigene Atelier (2008, Abb. 3) zum Erinnerungsort gemacht. Das dreiteilige Panorama lässt den Atelierbesucher nahe heran kommen, näher als sonst. Man wird vom Maler gleichsam an die Wände geführt, wo er Bilder – von sich aufgehängt hat. Röntgenbilder. Schmerzbilder. Bilder im Bild, die in behutsamer, keuscher Referenz die Erfahrung einer schweren Krankheit aufbewahren.
Handlungsarmut?Vielleicht stimmt der Befund von den menschenleeren Räumen ja doch nicht so ganz. Es gibt schon auch auf Figuren auf den Bildern von Martin Kasper12. Früher gelegentlich, in den letzten Jahren immer seltener. Meist gehören sie zur skulpturalen Staffage. Dass sie die Szenen bevölkern, die Räume beleben würden, wäre unzutreffende Charakterisierung. Eine Frau in der U-Bahn-Station. Sie scheint den Luftzug kaum zu verspüren, der ihr die Mantelschösse auseinander bläst. Sie steht wie Säule oder Pfeiler, und wenn ein Zug vor ihr hielte, sie stiege doch nicht ein. Und der Kellnerkopf hinter dem Tresen im Restaurant „Alex“ bildet mit Tellerstapel, Gläserset und Lichtspot ein veritables Stillleben. Dass von ihm viel Handlung ausginge, ließe sich schwerlich behaupten. So wenig wie die Gäste im riesenhaften Bowling-Center in irgendeine Spielhandlung vertieft scheinen. Niemand handelt, niemand tut etwas, nichts geschieht auf diesen Bildern. Und dies in merkwürdigem Kontrast zu den opulenten Zurüstungen für Handlung und Geschehen.
Man kann Statik und Statuarik dieser Bilder, die gefrorenen Situationen, die Handlungsarmut auf entleerten Bühnen, diese blockartige Wucht der Dinge und Architekturen auch als malerische Strategie gegen die zeitgenössischen Beschleunigungen verstehen, gegen die Verflüchtigungen, die Instabilität, den hektischen Stoff- und Ideenwechsel, der aus der innovationsgetriebenen Kultur resultiert. Diese Malerei muss nicht neu sein, wenn sie souverän sein kann. Und was sich da so irritierend unbeschwert an der Tradition misst, sollte nicht missverstanden werden als Rückzug oder Verteidigung. Näher kommt man dieser Malerei, wenn man ihre Verzögerungen, Reduktionen, Schematisierungen zeichenhaft nimmt, als ebenso überlegte wie überlegene Option gegen das virtuelle Phantasma der Erschlossenheit und Verfügbarkeit, als Plädoyer mithin für die Konstruktions- und Erschließungsbedürftigkeit von Welt.
Erinnerungshandlung?Welt, das sind die Bilder, die wir uns von der Welt machen. Soll man bei Martin Kaspers Bildern sagen „gedämpfte Welt“? Ein wenig stumpf sieht diese Welt ja aus, trocken, leicht verschattet, entrückt, entfernt, durch ein opakes Okular gesehen. Und die Dinge erscheinen wie abwesend, nicht ganz hier zu sein, von weit hergeholt, aus dem Gedächtnis belichtet, festgehalten auf einem Film, der alle Töne nach Moll hin moduliert. Das schafft eine eigentümliche Stimmung. Aber die „gedämpfte Welt“ ist kein romantisches Paradigma, kein Sehnsuchtsmotiv, indiziert nicht Traum oder Halbwachheit. Malen als Erinnerungshandlung, als Weise des bildhaften Versinnlichens und Vergegenständlichens ist ein überaus bewusster Vorgang.
Malerei, bewusste Malerei, kann nicht mehr so tun, als ginge es noch immer darum, die Dinge einfach umzusetzen, sie von ihrem Dingsein in den Zustand des Gemaltseins zu heben. Sie weiß vielmehr, dass zwischen dem Dingsein und dem Gemaltsein immer schon das Bildsein ist, dass die Dinge nicht anders und nicht eigentlicher erfahrbar sind denn als Bilder. Bilder aber existieren nicht in der stofflich begrenzten Form des Gegenstands mit festen Dimensionen und festen Bestimmungen. Bilder verweisen aufeinander. Sie sind immer zugleich Bilder von Bildern, existieren nur in der dynamischen Form der Bezüglichkeit. Das meinen diese auffällig weit geöffneten Räume. Sie verwachsen in der Summe zum eindrücklichen Zeichen der Unabgeschlossenheit und Unabschließbarkeit, um die es diesem Werk zu tun ist. Offenheit ist wie Leere. Offenheit und Leere sind starke Anstiftungen zum Sehen, zur aktiven Weiterarbeit, Sehweiterarbeit, Gedankenweiterarbeit am Bild. Museumsruhe im Museum. Lampengehänge erloschen. Vertagung im Konferenzsaal. Handelsschluss an der Börse. Alle Bänke vor dem Gate im Airport unbesetzt. Nichts los im Café. Doch, jetzt geht es erst richtig los. Der Sog, der von den Bildern ausgeht, der Sog in die weit offenen Räume hinein ist nicht weniger als Induktion eines Sehens, das sich mit der Empfindung so wenig zufrieden gibt wie mit der Erkenntnis.
Sehgeschichte Die Stills sind ja nicht einfach angehaltene Filme. Sie sind inszeniert, mit künstlichen, künstlerischen Mitteln in den Ruhemodus gebracht. Willentlich vereinfacht, geometrisiert, entrümpelt, von allem Illustrativen befreit, leergeräumt, um sie in Wahrheit auffüllen zu lassen und sie an ihre unabsehbare Sehgeschichte zu übergeben. Gerade im Abbau der Formen- und Dingfülle erlebt diese Malerei, wie die Formen und Dinge uneindeutig werden, magisch. Dann thront der Bildschirm wie eine konstruktivistische Skulptur auf dem Sockel, und die Rundbank im Museum lässt an einen Raumtransporter aus dem Science-fiction-Film denken, die futuristische Bar verwandelt sich in eine medizinische Apparatur und die U-Bahn-Station in ein Bühnenbild für ein erst noch zu schreibendes Stück mit vorerst unbekannten Haupt- und Nebenrollen.
Der leere Raum ist wie die Negativform um die fehlende Figur. Er ist das, was bleibt, wenn der Figurenkern aus seiner Gussform ausgeschmolzen wird. Es ist ja nicht so, dass die Bilder sagen wollten, die Räume kämen auch ohne den sie bewohnenden Menschen gut aus, bräuchten ihn gar nicht, um stabil und stark anzumuten, ungefährdet in Halt und Haltung. Martin Kaspers menschenleere Räume deuten alle auf ihr Gegenteil, auf ihre Menschenherkunft nämlich. Sie künden – zuweilen mit theatralischem Gestus – von dekorativen Bedürfnissen und Phantasien, von baumeisterlichen Grandiositäten. Auch als nüchternen Multifunktionsgehäusen eignet ihnen ein Hang zur Großartigkeit, zum gestalterischen Surplus, ein fremder, nicht ganz zeitgemäßer Schwung.
Anwesenheit?Wenn die Figur fehlt, wenn sie nicht auftritt, wenn sie sich nicht zeigt, heißt das also nicht, dass sie ausgeschlossen wäre, und heißt keineswegs, dass sich der Maler für das nichtfigürliche Fach entschieden hätte. Es sind allemal hilflose Oppositionen gewesen, die die kunstgeschichtliche Erzählung erfunden hat: figürlich – nonfigurativ, figürlich – abstrakt, gegenständlich – ungegenständlich. Denn immer und notwendig ist der Blick figürlich, von seinem körperlichen Substrat, von seiner Figürlichkeit nicht zu lösen. Es gibt kein ungegenständliches Sehen. Sehen ist angewiesen auf einen Körper. Der Blick kann zwar von den Dingen absehen. Er kann die Dinge in Formen, Zeichen und Ideen verwandeln. Aber auch so bleibt er figürlicher Blick. Und wenn wir sagen, der leere Raum sei wie die Negativform um die fehlende Figur, er sei das, was bleibe, wenn der Figurenkern aus seiner Gussform ausgeschmolzen werde, dann ist es immer zuerst der Maler selber, der in der Leerstelle, die er geschaffen hat, agiert und seine kenntlich unkenntlichen Spuren hinterlässt. Und es sind wir, die Betrachter am Bühnenrand, an der weit offenen Vorderseite der weit offenen Räume, die sehend agieren und sehend unsere kenntlich unkenntlichen Spuren am Bild hinterlassen.
Es sind Räume voller suggestiver Erlebnisqualität, die leeren Räume, die Martin Kasper malt. Und ihr innerstes Geheimnis ist, dass etwas psychisch anwesend scheint, was sich physisch nicht zeigt, nicht zu zeigen braucht. Die Figuren müssen nicht sichtbar sein, um sie sehen zu können. Das Stück muss nicht auswendig gelernt werden, um die Rollen aufsagen zu können. Denn das Traumartige, Albtraumartige, das faszinierend Befremdliche, das man zu spüren meint, dieser Schauder, wenn Dach und Wände von menschengemäßer Wohnbarkeit zeugen, und doch kein Mensch da ist, der in den Wohnungen wohnen wollte, das alles ist doch nur unsere eigene Sehzutat, unser eigenes Verdrängtes, das die leere Bühne braucht, die Zeichenlosigkeit und die ungeklärten Zeichen, um sich jählings zu erfahren. Der leere, aus- und aufgeräumte physische Raum ist wie eine sinnliche Brücke in den dunklen, verstopften, unaufgeräumten psychischen Raum. Ob es den Langen Flur entlang geht ins Verhörzimmer oder von der space-shuttle-förmigen Rundbank im leeren, sich selber ausstellenden Museum geradewegs ins Atelier: Es sind allesamt Innenräume. Und wenn die Innenräumen auch nicht von der Art sind, dass man wirklich drin wäre, sich innen wähnte oder fühlte, wie in einer virtuellen Architektur spazieren gehen, die Perspektive wechseln, die rätselhaften Details in der Nahsicht besser verstehen könnte, wenn man also keinen Schritt vorankommt und wie angewurzelt stehen bleibt, sehend stehen bleibt, dann ist man doch mitten in ihnen – als ihr eigentlicher Bewohner.
1 Bei dem Tanzsaal handelt es sich um „Klärchens Ballhaus in Berlins Mitte“, wie Martin Künzig schreibt: „Korrektur des Raumvergessens“ in Martin Kasper „ausgeräumt“, Solothurn 2007, o.P.2 etwa Observation, 2006 oder Kuznetsky Most, 2008 (Abb. 11)3 etwa Flur, 2008 (Abb. 12)4 z.B. demnächst, 2007 (Abb. 8), Polska II, 2007 oder Zwischen den Türen, 20075 „Ausgeräumt“ hiess Martin Kaspers Ausstellung im Haus der Kunst St. Josef in Solothurn (15. September bis 14. Oktober 2007)6 20067 Franz Kafka „Der Prozess“, 2. Kapitel8 20079 wie Anm. 7, 3. Kapitel10 Dazu ist kein Widerspruch, wenn Bernd Künzig schreibt: „Für Martin Kasper sind es anschauliche Räume , die sich in zentralperspektivischer Perfektion darstellen lassen, und gleichzeitig solche der Anschauung, die das Sehen selbst thematisieren: die Raumdarstellung ist Ausdruck dieser Inszenierung des Sehens. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Faszination des Künstlers für Kinos, Theater, Überwachungszentralen, Wartehallen, und oyers; sie alle dienen diesem Theater der öffentlichen Wahrnehmung.“ In Martin Künzig wie Anm. 111 Konferenz, 2005 oder ohne Titel, 200512 Zum Milosevic-Prozess in Den Haag ist im Jahr 2004 eine ganze Serie von Tribunal-Bildern entstanden.

RAUMERINNERN Hrsg: Wendelin Renn, Städtische Galerie Villingen-Schwenningen, 2007
mehr»
mehr»
Multipe Räume
Malen heute bedeutet nicht nur zu malen, sondern auch die Bedingungen, die formalen und sinnlichen Grenzen der Malerei zu hinterfragen.Die großen künstlerischen Revolutionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben dazu geführt, daß die Bildende Kunst sich von der vormals für selbstverständlich gehaltenen naturalistischen Darstellung der Realität verabschieden hat. So wurden die anerkannten Vorstellungen von Perspektive und Tiefenwirkung aufgegeben. Es verschwanden die Gegensätze zwischen Oberfläche und Hintergrund, Form und Inhalt. Das Verhältnis von Kontur und Farbe, Bildthema und Bildgegenstand, von Innerlichkeit und Äußerlichkeit des Dargestellten beziehungsweise des Wahrgenommenen wurde neu bestimmt. Es kam zu einer Verschränkung gegenständlicher und abstrakter Darstellungsweise und das Dogma von der formalen Einheit des gemalten Bildes wurde aufgehoben. Damit befreite sich die moderne Malerei in ihrer repräsentativen Funktion von der reinen Mimesis. Die formalen und materiellen Bestandteile der Malerei haben in der Folge eine Eigendynamik entwickelt, die die Malerei von der Realität abgekoppelt hat. Gleichzeitig hat sie unsere visuelle und physische Wahrnehmung sowie unser Verständnis der Wirklichkeit erneuert. Als Erbin dieser radikalen Veränderungen erforscht die zeitgenössische Malerei nunmehr auf subtile Weise sowohl die Bedingungen, Grenzen und Möglichkeiten formaler und sinnlicher Wahrnehmung der dargestellten Dinge, als auch ihre eigenen Grundlagen der Formbildung. Ein solchermaßen eingeschlagener Weg führt zur Aufhebung der gewohnten Wirklichkeitswahrnehmung und legt eine Veränderung der Realitätserfahrung nahe. Diese zeigt sich belebt durch ein freies, von gewöhnlicher Wahrnehmung unabhängiges, szenisches und bildhaftes Formenspiel, das über die sichtbaren Erscheinungen hinausführt. Dieses Formenspiel findet inmitten einer an Leere und Unbestimmtheit grenzenden Dimension statt, die auf unterschwellige Weise unsere visuellen und sensorischen Wahrnehmungen vom Raum, den Orten und den Bildern strukturiert. Eine solche künstlerische Entwicklung findet nicht nur im Bild statt. Sie ist auch eine Folge der materiellen Veränderungen unserer Realitätserfahrung. Wenn ein Körper von raschen Bewegungen erfaßt wird, gruppieren sich die instabilen Fluchtlinien, die unseren Blick organisieren, um das Zentrum einer neuen, zusätzlichen Dynamik, die ursprünglich Dynamik überlagert. Im Blick des Betrachters verschieben sich autonom die formalen Anordnungen im Raum, sodaß sich zwischen den verschiedenen Zuständen Intervalle der Leere ergeben. Der Bewegungsprozeß führt zu einer Auflösung und Neubildung der Formen und verwandelt die Natur des Bildes in seiner Hervorbringung - genau das ist gesehene Extase
Weil sich Martin Kasper mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt, muß er als ein ganz entschieden moderner Maler gelten. Er ist geprägt von der kritischen Art des Denkens, welche durch die deutsche und französische Aufklärung zu Ende des 18. Jahrhunderts aus der Taufe gehoben wurde, um den Ursprung unseres modernen Denkens und schließlich einer experimentellen Kunst zu bilden, die zu Distanzierung und Abstraktion befähigt sein sollte. Zwar ist er ein purer Maler im professionellen Sinne, der fähig ist, Figur, Volumen, Linien und Farben mit Feingefühl und Geschick spielerisch umzusetzen, um damit die Illusion einer visuellen Darstellung von Orten dieser Welt zu erzeugen. Darüber hinaus hinterfragt er aber auch die intellektuellen, spirituellen und sinnlich wahrnehmbaren Möglichkeiten, die das gemalte Bilde dem menschlichen Subjekt bietet, und das in einer Zeit, die weitgehend von Bildern dominiert wird, welche technisch fabriziert, produziert und über Bildschirme ausgestrahlt werden. Eine derartige Omnipräsenz dieser Bilder, die unsere Wahrnehmung so stark prägen, hat vermehrt dazu geführt, der Malerei als Kunst nur noch eine nebensächliche Rolle beizumessen angesichts des dominanten Stellenwertes technisch produzierter Bilder in der visuellen Welt. Und doch lehrt uns die Malerei, wenn sie weiterhin betrieben wird, daß Betrachten und Darstellen nicht nur Sehen und mechanische Reproduktion des Wahrgenommenen bedeuten, sondern die unendlich vielen Konfigurationen zu analysieren und herauszuarbeiten, die sich hinter dem Wahrgenommenen verbergen. Diese Konfigurationen sind indessen sowohl von sinnlich wahrnehmbarer und materieller als auch formaler und bildhafter Natur und jede dieser Konfigurationen ist dazu angetan, in einer frei verwandelten Form erfahrbar zu werden. Auch wenn der figurativen Produktion in den neuen Medien diese Fragestellung nicht völlig fremd ist, scheint der singuläre Gestus des Malers im Verhältnis zu technisch produzierten Bildern eine radikalere Kraft bewahrt zu haben, die Welt zu symbolisieren. Das macht ihn für die wahrnehmende Welt zu einem Faktor von Freiheit und erfinderischer Kraft, weil er im Zusammenspiel der bildnerischen Rhythmen und Energien den neuen Gesetzen, die unser Sehen nunmehr bestimmen, konkreten Ausdruck verleiht.
Heutige Malerei kann sich nicht mehr naiv geben, als wüsste sie nichts von den Bildtechnologien und ihren Einflüssen auf den Körper und seine Wahrnehmung. Das Werk von Martin Kasper ist bildnerisch gesehen im Zentrum dieses Spannungsfeldes der visuellen Welt anzusiedeln. Man gewinnt angesichts seiner Arbeit den Eindruck, dass das gemalte Bild, das ganz klassisch Zeugnis ablegt von einer intentionalen Präsenz in der Erfahrungswelt und sich subjektiv evokativ und unbeweglich gleichermaßen darstellt, der Fiktion eines Bidschirm-Projektors als Norm der Realität und der optischen Wahrnehmung entgegentritt. Hier werden mit Hilfe des Bildschirms Bilder übermittelt, die magnetische und dynamische Wirkung entfalten, aber auch mimetische Leitfunktion besitzen für die individuelle Erfahrung eines simultanen Zustandes von Anwesenheit und Abwesenheit, der das Resultat der faszinierenden Vervielfältigung der Bilder und ihrer Intensität ist. Diesbezüglich wäre das Gemälde bei Martin Kasper keine neo-naturalistische oder objektivistische Abbildung, sondern Ort einer subjektiven Erfahrung der Repräsentation der Welt durch gemalte Bilder im Zeitalter der dominierenden Technologie der Kommunikationsmedien. Der hier beschriebene Blick eines menschlichen Subjekts auf die Realität wäre phänomenologisch verstrickt in die dynamische Vervielfältigung von Perspektivebenen und Spiegelbildern, von undurchsichtigen Widerständen und fließenden Transparenzen. Eine solche Erfahrung würde sich herleiten von dem Eindruck, der sich aus der gleichzeitigen Wahrnehmung einer substantiellen Leere der Dinge, einer Intensivierung der Blickachsen und der sowohl den Dingen wie auch den Bildern innewohnenden Dynamik ergibt. Sie wäre das Ergebnis einer wachsenden Flut an Bildern und Abbildern, die auf Strahlungen physikalischer Art basieren und unmittelbar auf den menschlichen Organismus einwirken. Gleichzeitig wäre diese Dynamik durch die fixierende und verdinglichende Eigenschaft der Fotografie unterbrochen. Von einer Subjektivität dieser Malerei auszugehen, erscheint umso paradoxer, als die meisten Gemälde von Martin Kasper frei sind von der Darstellung menschlicher Figuren oder gar von Leben allgemein. Seine Gemälde stellen urbane Orte oder Gebäude dar, die weder real noch fiktiv sind, auf objektive, beinahe realistisch Weise dargestellt werden, aber wie verlassen erscheinen. Im Unterschied zu den Bildern von Edward Hopper, welchen sie durch ihre formale Struktur verwandt sind, sind sie menschenleer. Dazu gehören zum Beispiel die leeren Zoo-Käfige, die sich selber überlassenen Pavillons der Biennale von Venedig, Gebäudehallen, Wartesäle, Flure, Metrotreppen und -bahnsteige, ein Kontrollraum, Gebäudeinterieurs, eine Bildergalerie, ein Krankenhausflur, ein Wasserbecken oder eine im Bau befindliche Ausstellungshalle. Beim Betrachten der Bilder erhält man zunächst einen Eindruck der Immobilität, des In-der-Schwebe-gehalten-seins, als ob diese Orte fotografische Stilleben, sowie Darstellungen einer verlassenen Welt seien, die sich aus mehr oder weniger sinnentleerten Bildern konstituiert, aber kurioser Weise perfekt harmonisiert sind. Wie bei Oskar Schlemmer scheinen sie auf eine ausgewogene Begegnung zwischen den Spären des Realen und des Imaginären abzuzielen, wobei die Perspektiven des realen Raumes mit denjenigen des gemalten Raumes verschmelzen. Allen Bildern ist gemeinsam, daß auf ihnen Orte modernen Lebens sichtbar werden, die auf Grund ihrer eigenen Strukturen die gleichen gegenständlichen und figürlichen Eigenschaften besitzen: geometrische Regelmässigkeit von Volumen und Formen, spiegelnde Oberflächen, vielfache Scheiben und Trennwände, architektonische Konstruktionen von Tiefen- und Raumverhältnissen, zahlreiche Flucht- und Kreislinien, Verschachtelungen von Oberflächen und Volumen und künstliche Farb- und Lichtspiele. Man könnte sie deshalb als Malerei ohne Subjekt, ohne jegliches menschliches Subjekt bezeichnen. Das wäre allerdings ein Widerspruch in sich, da auch diese Malerei abhängig ist von der Präsenz eines Betrachters und von der Strukturierung, die das Bildgeschehen durch dessen Blick erfährt. Die Malerei Martin Kaspers fordert den Betrachter zur subjektiven Inszenierung seiner eigenen Sichtweise des Gemäldes auf und bietet sich selbst als Analyse -und Konstruktionsgrundlage dieses Blickes an, dessen Inszenierung im Betrachter provoziert werden soll. Sie ist hierbei also sehr wohl eine kritisch bewußte Malerei, eine Inszenierung der aktuellen Wahrnehmungsbedingungen im leeren Raum, der sich vervielfältigt in einer seltsamen, gemalten Galerie von Orten und Bildern. Im Unterschied zum 18. Jahrhundert ist der Ort unseres Erfahrens nicht mehr der Ort direkter Wahrnehmung , in der eine Erfahrung zum Ausdruck kam, die sich zusammensetzte aus der Vielfalt der Dinge unmittelbarer Körperlichkeit, sondern die Rezeption von Abbildern bereits konstituierter, durch technische Apparaturen und Bildschirme vorgefilterten Wirklichkeit. Was die aus der Modernität hervorgegangenen formalen und malerischen Komponenten betrifft, so haben wir diese vielleicht schon unbewusst in unserer Erfahrung aufgenommen.
Die Bilder, die durch eine leistungsstarke Technologie gewissermaßen materialisiert wurden, sind zu so etwas wie der Substanz der uns umgebenden Mauern geworden und nicht weit entfernt davon, ihre Bauweise zu bestimmen. Unsere hyper-urbane Existenz konfrontiert uns mit einer Art Bildschirmzukunft, Bildzukunft, in welcher sich alle materiellen, errichteten Oberflächen nach und nach in Projektions-, Diffusions- und Reflexionsflächen verwandeln und wie Bildschirme wirken. Diese Oberflächen erscheinen uns also inmitten einer Architektur der Bilder als Träger optischer Spiegelungen, Beugungen und Brechungen, die ebenso Anziehungspunkte wie verstreute Reflexe der erlebten Welt sind. Außerdem hat das Bild sich durch Kino und Video sowie durch Beleuchtungstechniken, Informatik und synthetische Bilder zu einem Phänomen entwickelt, in dem Form und Bewegung sich wechselseitig bedingen, und das von abstrakten, konkreten und kinetischen Spuren und Intensitäten durchzogen ist. Auf Grund dieses Sachverhaltes sind wir geneigt, die Dinge, belebt durch physikalsche Impulse in einem freien Spiel der Kräfte, als dynamische fließende Bewegungen wahrzunehmen und uns zu vergegenwärtigen, daß diese zur manifesten Form der Dinge werden. Auf der bildnerischen Ebene äußert sich das in der Konstruktion strahlungsförmiger, konvergierender und divergierender Fluchtlinien sowie in einer Interaktion zwischen den Lichtzonen im Bild, wodurch das Bild seine spannungsgeladene Grundstruktur erhält. Es ist, als ob die sichtbare Realität die Eigenschaften der «Zentrifuge» von Alexandra Exter angenommen hätte, nämlich die Eigenschaften einer energetischen Dynamik von Formen und Farben, die aus Lumineszenzen, Bewegungen abstrakter Figuren und Interaktionen zwischen den verschiedenen Ebenen und Farben bestehen. Das Szenarium der Betrachtung sieht sich dadurch in entscheidender Form verändert. Es muß von nun an in einen Zusammenhang gebracht werden mit der Erfahrung, die ein Körper macht, der unabläßig eine simultane Veränderung seiner räumlichen Koordinaten und seines eigenen perspektivischen Bezugsfeldes erfährt und ihn über die Grenzen individueller Wahrnehmung hinaus führt. Das entspricht einer Erfahrung, die man, um sich vom Kubo-Futurismus Vladimir Tatlins und Kasimir Malewitschs inspirieren zu lassen, als „ungegenständlich“ bezeichnen könnte, weil sie vom Spiel rein formaler Strukturen definiert wird. Diese formale und artifizielle Disposition führt direkt zur unmittelbaren Ansteckung der natürliche Wahrnehmung und ersetzt diese. Jene technischen Systeme, die uns mental und körperlich durch Bilder manipulieren, sind ebenso sehr interne wie externe Handlungsfaktoren einer allgemeinen Transformation unserer Wahrnehmungen der Realität. Zur Vermehrung der Bildschirme gesellt sich die zunehmende Komplexität der visuellen Phänomene von Transparenz und Reflexion inmitten der urbanen Erfahrung. Wir leben umgeben von spiegelnden oder transparenten Oberflächen, die in ständiger Interaktion eine Vervielfältigung der optischen Reflexe und eine Auflösung der Konturen und der Bildträger hervorrufen. Diese Auflösungserscheinungen vollziehen sich im Zusammenwirken von Wahrnehmungsfluß, Geschwindigkeit und verglaster Bidschirmrealität, die uns umgibt mit ihren Effekten und Intensitäten. Das gleiche vollzieht sich in der futuristischen Malerei, wo jedes Element in spezifischer Form dynamisch aufgeladen ist und wo man eine enge Verkettung solcher Elemente im Spiel der Kräfte beobachten kann.
Glatt, geschlossen, offen, simuliert, verhüllt, undurchsichtig, transparent, widerspiegelnd, statisch, dynamisch – die materiellen Oberflächen, denen sich unser Blick zuwendet, sind oft paradox, egal ob sie sich mit Bildern erfüllen oder nicht. Dem Betrachter fällt es spontan schwer, herauszufinden, ob es Tiefe und Relief gibt, ob Illusion oder Realität vorliegt, ob er es mit einer formalen Konstruktion oder mit einer natürlichen Wahrnehmung zu tun hat. Das Phänomen der vagen und unbestimmten Form des optischen Reflexes und das Phänomen der artifiziell erzeugten Bilder scheinen sich vervielfältigen zu müssen und tragen in den meisten unserer visuellen Wahrnehmungen zu Kontextverlust und zunehmender Verunsicherung bei. So kommt es zu einer Verschmelzung von Bild und Realität, die Begriffe von nah und fern werden umkehrbar, Innen und Außen ersetzen sich gegenseitig. Ja, mehr noch: die formale, abstrakte, bildnerische Anordnung der Dinge und der Blickorientierung können sich tatsächlich mit der Form der Objekte und der Beschaffenheit der Orte vermischen. Dann wird die Differenz zwischen Darstellung und Wahrnehmung sehr schwach, als ob die formalen Techniken der modernen Kunst, des Konstruktivismus, nun wirklich an die Stelle der natürlichen Konstitution der Dinge getreten wären, um deren Natur zu befreien. So sind Körper und Formen geometrische Figuren, die Tiefe eine Ebene, die Perspektive eine strahlenförmige Linie, das Licht eine Spannung der Farbe, die Bewegung eine Ausrichtung der Volumen, das Bild ein dynamisches Spiel von interaktiven malerischen Kräften. Mit einer solchen Erfahrung verschwinden die Eindrücke von Perspektive, Horizontalität und Vertikalität zwar nicht ganz, aber sie verlieren und brechen sich in vielfältiger Form. Martin Kaspers Gemälde dokumentieren all diese Vorgänge als gleichsam erstarrte Phänomene. Bei deren Thematisierung und Bestimmung, ist Martin Kasper nicht nur um Objektivität bemüht, sondern auch um die Hervorbringung einer reinen Malerei. Er ahmt die Realität nicht nur nach, er erzeugt sie auch. Bei ihm sind die Bilder Bilder von Bildern: der zusammengesetzte und unechte Reflex eines künstlichen Reflexes. Letztendlich setzt sich unsere Wirklichkeit aus all diesen Komponenten zusammen. Die Realität wird zur Potenz des Möglichen, dessen faktischen Verwirklichung unser eigenes Werk ist. Es bleibt uns nichts anderes, als in Kaspers Bilder einzutreten, denn sie sind kein fiktives vor uns dargestelltes Außen, sondern eine der möglichen Formen unserer subjektiven Erfahrung der Dinge durch das Auge. Das gemalte Bild wird zu einer Art «Raum-Modulator» , so etwa wie diejenigen, die Moholy-Nagy konstruiert hat. Kunst ist dann nicht mehr getrennt vom Leben, sodaß sich das Programm von Walter Gropius wohl vor unseren Augen realisieren kann. Das Unendliche der Möglichkeiten liegt nun unmittelbar vor unseren Augen ausgebreitet.
Emmanuel Brassat (dt. Übersetzung: Kasper)
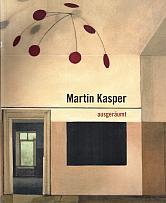
Martin Kasper, ›ausgeräumt‹, Text: Bernd Künzig, hrsg: Haus der Kunst St. Joseph, Solothurn, 2007
mehr»
mehr»
Bernd Künzig Korrektur des Raumvergessens. Die Malerei Martin Kaspers
Wenn man die Malerei Martin Kaspers auf einen zusammenhaltenden Begriff bringen müsste, dann wäre „raumerinnern“ sicher keine schlechte Wahl. Damit ist zum einen von einem Gedächtnis die Rede, das sich Raumeindrücke wieder zu Bewußtsein führt. Zum anderen berichtet ein solcher Begriff aber vom Verlust, vom Vergessen des Raumes. Die scheinbar fotografische Präzision der Bilder Martin Kaspers führt mit diesem Scheinhaften den oberflächlichen Blick auf eine falsche Fährte: es geht keineswegs um ein Festhalten privater Eindrücke, wie wir dies mit dem Fotoapparat betreiben, um mit diesen Bildern zu signalisieren, man wäre da gewesen und dass diese Anwesenheit umlagert ist von Sinneseindrücken, Geschichten und Begegnungen. Der genauere Blick offenbart demgegenüber die spezifischen malerischen Gesten, mit denen hier Räume porträtiert werden, deren Grundlagen ein fotografisches Bild sein kann, das sich aber im malerischen Gestus dieser Bilderfindungen verflüchtigt hat. Zum anderen sind die Raumbilder Martin Kaspers für den Ausstellungsraum bestimmt und keinesfalls auf ein Privatissimum beschränkt. Sie wollen zuvorderst als Teil einer Öffentlichkeit gelesen werden, die sich anhand ästhetischer Fragestellungen gleichfalls mit gesellschaftlichen Problemstellungen auseinandersetzt. In jüngster Zeit hat die wissenschaftliche Kritik verstärkt auf die Raumvergessenheit hingewiesen. Der Soziologe Markus Schroer hat mit einer bedeutenden Untersuchung sich bemüht, an einer „Soziologie des Raums“ zu arbeiten und dabei einleitend auf ein grundlegendes Paradoxon aufmerksam gemacht: „Auf der einen Seite ist der Raum sehr konkret, da er uns ständig zu umgeben scheint, wir uns ständig ‚in‘ ihm aufhalten. Wir können Raum erfahren, können Räume begehen, betreten und wieder verlassen. Auf der anderen Seite ist der Raum äußerst abstrakt. Können wir uns unter ‚Lebensraum‘ noch etwas Konkretes vorstellen, scheint schon der ‚Weltraum‘ nicht mehr recht fassbar, weil er sich in seinen unendlichen Weiten und seinen immer noch expandierenden Ausmaßen unserer Erfahrung entzieht. Schon Pascal notiert angesichts dieser Unermesslichkeit des Raumes: ‚Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.‘“ Im Kontext einer globalisierten Welt ertönt der Abschiedsgesang auf den Raum, der durch die Kategorie der Zeit abgelöst werde. „Auffällig dabei ist“, so Markus Schroer weiter, „dass die These von der Irrelevanz des Raums stets dann ertönt, wenn von ökonomischen Prozessen die Rede ist. Wann immer es dagegen um politische Zusammenhänge geht, wird die notwendige Bindung an den Raum betont.“ „Während hier der Raum verschwindet, weil die Entfernung zwischen zuvor isolierten Orten mühelos überbrückbar wird, gilt aus einer soziologischen Perspektive heraus genau umgekehrt, dass Raum durch die gegenseitige Erreichbarkeit vormals isolierter Orte erst entsteht. Insofern haben wir es keineswegs mit einem sukzessiven Verlust des Raums zu tun. Eher wäre von einer steten Raumvermehrung zu sprechen, da jedes Medium zusätzliche Räume erschließt und schafft. Dass wir im Zeitalter des Raums leben, hat vor allem damit zu tun, dass uns die Dinge immer weniger im Sinne eines zeitlichen Nacheinanders erscheinen, sondern immer mehr in einem räumlichen Nebeneinander. Wenn es eine sinnvolle Bestimmung des Postmodernebegriffs gibt, dann besteht er eben in diesem Bewusstsein eines Nebeneinanders, das das moderne Nacheinander ablöst.“ Dem Nebeneinander, der Gleichzeitigkeit von Räumen hat Martin Kasper in zahlreichen Bilderfindungen einen bildnerischen Ausdruck verliehen. Immer wieder öffnen sich in den Raumkonzeptionen auf der Leinwand Fenster und Türen, die Ein- und Durchblicke in andere Räume erlauben. Die Fenster und Türen, die diese Öffnung im realen Raum als Passage ermöglichen, werden im Gemälde zu Rahmensetzungen, die weniger als Übergänge funktionieren, sondern Bilder von anderen Räumen in das große Raumbild einklinken. Die Raumbilder Martin Kaspers öffnen sich damit der Bild-im-Bild-Systematik, die die Entwicklung der modernen Kunst seit der Erfindung der zentralperspektivischen Konstruktion in der Renaissance umgetrieben hat. Nur zeitweilig hat die Monochromie der abstrakten Malerei der fünfziger Jahre diese Kontinuität einer labyrinthischen Fülle zugunsten der Leere zurückgedrängt. Nicht zuletzt die Renaissance des Surrealismus im Zusammenhang der Konzeptkunst der sechziger und siebziger Jahre öffnete das Faszinosum der Bilder-im-Bild erneut unter politischen, sozialen und philosophischen Aspekten, die sich der grundsätzlichen Konstruktion und damit Fiktion von Bildern versichert, um den abbildenden Realismus zurückzuweisen. Auch in diesem Anknüpfungspunkt erweist sich das Werk Martin Kaspers der hyperrealistischen Simulation von fotografischem Realismus abhold. Vielmehr knüpfen auch seine Bildwerke an das Mittelalter an. Die mittelalterliche Wappenkunde, die sogenannte Heraldik kennt einen treffenden Ausdruck für diese labyrinthischen Raum- und Bildverschlingungen: „Mise en abyme“ – in den Abgrund stellen. So blickt auch der Betrachter im Falle von Martin Kaspers Bildwerken in den Abgrund eines Sogs von Raumbildern, in deren Gängen, Tür- und Fensterblicken sich weitere Raumfluchten ergeben. Es ist ein Labyrinth, in dem sich der Betrachterblick verstrickt, ohne körperlich in diesen Bildfluchten anwesend sein zu können. Die im Großen und Ganzen im Werkkomplex Martin Kaspers vorherrschende Abwesenheit des Körperlichen in diesen Raumdarstellungen, verweist sie nicht nur an die Leere, sondern auch an eine Offenheit, die angefüllt werden kann mit Historie und Erzählung. Darin sind sie durchaus den leeren Bühnenbildern verwandt. Nicht ohne Grund findet sich auf dem Arbeitstisch des Künstlers eine sorgfältige Dokumentation der Arbeit der Bühnenbildnerin Anna Viebrock, die diesen Zweig des Bilddiskurses in den vergangenen zwei Dekaden grundlegend neu bestimmt hat, in dem sie der theatralischen Darstellung fotografisch exakte Raummontagen gegenübergestellt hat, deren starke Präsenz nur durch höchste Inszenierungskunst überstanden werden kann. Wie die starken Bühnenräume der Viebrock die Kunst der Darstellung auf den Prüfstand stellen, so stellt auch die Malerei Martin Kaspers die Dominanz des Bildlichen in einer von Bildmedien bestimmten Zeit auf den Prüfstand. Die Beschleunigung der Bilder, die wir durch das globale Internet erfahren, wird hier konterkariert. Wo die Computertechnologie im Sinne des globalen Dorfes den Raum scheinbar zum Verschwinden bringt und ihn durch die Beschleunigung in hyperaktive Gleichzeitigkeit aufzulösen wünscht, reagiert die Malerei Martin Kaspers mit der bewegungslosen Ruhe und Statik des leeren Raums, der hier in einem theatralischen Sinne zur Darstellung, zur Aufführung gelangt und den Betrachter auf seine Rolle als Zuschauer zurückwirft. Die Malerei Martin Kaspers ist kein interaktives Kunstwerk, das sich des Betrachters versichert, in dem es sich mit ihm zu scheinbarer Mitaktivität anbiedernd verbündet. Sie ist darin ein verinnerlichtes Persönliches, nicht nur Veräußerlichung von Räumen, sondern deren Überführung in eine persönliche Handschrift, die sie uns nicht zuletzt auch als Selbstporträts eines Künstlers im postmodernen Zeitalter erfahren lassen. So ist eigentlich der Körper verschwunden, um dem Raum Platz zu machen, an den wir Betrachter urplötzlich erinnert werden. Ein die Zeitenwende überdauernder Tanzsaal wie Klärchens Ballhaus in Berlins Mitte ist so nicht nur Ort einer die historischen Verwerfungen überdauernden Ostalgie, die im haupstädtischen Kulturbetrieb längst zu einem besonderen Ort der theatralischen Darbietung geworden ist, sondern selbst eine Raumperformance, der Martin Kasper in drei Arbeiten nachgegangen ist. Es ist nicht nur der „Duft aus alter Märchenzeit“, der sich hier synästhetisch auf der Leinwand niedergeschlagen hat, sondern eine bewußte Theatralik des Raums, die entweder dokumentarisch in dieser Malerei festgehalten oder Teil ihrer zentralperspektivischen Inszenierung geworden ist, mit der dieses Zeit- und Raumbild zum Bühnenbild gerinnt. Die Akteure in dieser Rauminszenierung sind allerdings nicht Figuren, Paare und Passanten, sondern die auf die Tische gestellten Stühle als stille Partner humaner Aufräumaktionen, die scheinbar planlos im Raum platziert wurden. Als einsamer Protagonist schwebt ein Kronleuchter in der oberen Mitte. Er ist Zeitzeuge dieses Raums, der nichts von dem ausplaudert, was er erlebt hat. Er spricht nicht selbst, sondern wird von dieser Malerei zum Sprechen gebracht. Dieser Kronleuchter ist ein etwas abgeranzter Zeitgenosse eines Chics, der bereits zu der Zeit, in der er an der Decke dieses Tanzsaals befestigt wurde, ein vergangener war. Er steht für eine Gesellschaft ein, die sich ihres eigenen Untergehens bewußt ist und sich dennoch für ihre Spurlosigkeit zu entschädigen versucht. Die Entschädigunsstrategie ist die der Artifizialität, zu der die Raummalerei Martin Kaspers tendiert, um das langsames Übergleiten in den Zustand des Verschwindens als Raumerinnern zu bannen. Diese Malerei ist in der Verweigerung jeglicher Abstraktion darin dem 19. Jahrhundert verwandt, wie es Walter Benjamin als maßgebliche Tendenz der Moderne beschrieben hat. Was für den deutschen Philosophen noch für die bürgerliche Wohnung galt, das lässt sich im postmodernen Zeitalter der Malerei Martin Kaspers für den offizielle Raum sagen, der der eigentliche Gegenstand dieser Kunst ist. Sie hat das Private längst aufgegeben, weil das zerfallende Öffentliche viel individualistischer ist, als die stets gleichen Wohnungen mit ihren im Bildschirmlicht der Computermonitore dämmernden Zimmern. „Seit Louis Philippe findet man im Bürgertum das Bestreben, sich für die Spurlosigkeit des Privatlebens in der großen Stadt zu entschädigen. Das versucht es innerhalb seiner vier Wände. Es ist als habe es eine Ehre darein gesetzt, die Spur, wenn schon nicht seiner Erdentage so doch seiner Gebrauchsartikel und Requisiten in Äonen nicht untergehen zu lassen. Unverdrossen nimmt es den Abdruck von einer Fülle von Gegenständen; für Pantoffeln und Taschenuhren, für Thermometer und Eierbecher, für Bestecke und Regenschirme bemüht es sich um Futterale und Etuis. Es bevorzugt Sammet- und Plüschbezüge, die den Abdruck jeder Berührung aufbewahren. Dem Makartstil – dem Stil des ausgehenden Second Empire – wird die Wohnung zu einer Art Gehäuse. Er begreift sie als Futteral des Menschen und bettet ihn mit all seinem Zubehör in sie ein, seine Spur so betreuend wie im Granit die Natur eine tote Fauna.“ Vergleichbar dieser Beschreibung der Wohnung des ausgehenden 19. Jahrhunderts durch Walter Benjamin, werden die Räume der Malerei Martin Kaspers, die nahezu alle von der Patina des Untergangs befangen sind, zu solchen Futteralen. Sie sind entleert, ohne Personen, zu Hüllen geworden von Gegenständen und seltsamen Dingen, die erst durch den malerischen Gestus in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden. Die Räume sind Futterale für den Kronleuchter und die Stühle in Klärchens Ballhaus. Oder im dargestellten Nebenraum für die Ziehharmonika-Lampions, die um die nackte Glühbirne gehüllt sind. Auffällig auch die gerahmten Bilder, die nicht genau zu entziffern sind: eine verwischte braune Landschaft im Nebenraum von Klärchens Ballhaus; ein überhöht gehängtes Porträt mit darunter befindlicher, nicht zu lesender Gedenktafel in einer von Karomustern und grünem Anstrich dominierten Bahnhofswartehalle; die Anzeigetafeln auf der rechten Wandseite des Flughafen Tempelhofs, die in der malerischen Darstellung wie Bildzitate von Gemälden Mark Rothkos oder Helmut Federles mit ihren signifikanten Farbfeldern erscheinen. Sie erweitern die Bild-im-Bild-Strategie der Fenster- und Türdurchblicke oder der gespiegelten Räume (wie in Klärchens Ballhaus) zu fremdartigen Kunsträumen. In der Darstellung eines Kinofoyers schwebt ein seltsames Mobile mir roten Kreisen, das den Blick magisch auf sich zieht und eine verwirrende Reminszenz an ein skulpturales Objekt von Alexander Calder erzeugt. Die Malerei Martin Kaspers fokussiert damit nicht allein den Gesamtraum, sondern benutzt ihn als überdimensionales Futteral von scheinbar nebensächlichen Dingen und Gegenständen, die plötzlich zu einer eigenen Welt des Bildnerischen und Skulpturalen geworden sind. Sie verstricken den Blick in die Details des Raums und üben einen Sog nach Innen aus. Wie im Theater ist die vierte, nach vorn abschließende Wand transparent gemacht, in dem dem Betrachter der Zugriff auf die anderen drei Wände gestattet wird. Die Fülle der Details zieht den Blick in diesen Innenraum hinein und verstrickt ihn aussichtslos darin. Innen und Außen stehen sich damit dialektisch Gegenüber. Die sorgfältige Malerei, die sich der handwerklichen Tradition der Tempera-Technik bedient, bedarf des geschlossenen Atelierraums, um in diesem Innen als Verinnerlichtes das auf der Leinwand zu bannen, was als Erfahrung im Außen gemacht wurde. Denn Martin Kasper ist ein irdisch verhafteter Raumfahrer, dem es keinesfalls genügt, von fotografischen Vorlagen zu zehren. Seine Raumdarstellungen basieren in der Regel auf konkreten Erfahrungen und Recherchen in der Urbanität verschiedenster Metropolen. Die Erfahrungen, die sich in der malerischen Darbietung von U-Bahn-Stationen, Wartehallen, Foyers, Kinos, Theatern, Überwachungszentralen oder Fernsehräumen niederschlagen, gerinnen zu schweigenden Räumen, die dennoch auf Gebrauchszusammenhänge des Sozialen, Politischen und Kulturellen verweisen, wenngleich sie zögernd als humane Aktionsräume dargestellt werden. Nur selten ist die menschliche Figur in diese Raummalerei eingezogen. Und dennoch: es handelt sich um Bühnen des Gesellschaftlichen. In den Arbeiten, die sich mit Affenhäusern verschiedener Zooanlagen befassen, sind sowohl Tier und Mensch verschwunden. Derartige Räume sind fundierte Inszenierungen der Beziehung von Mensch und Welt. In ihnen schlägt sich jener abgründige Umgang mit dem fremden Außen nieder, das nun heimgeholt zu einer unterkühlten Inszenierung der zivilisatorischen Aneignung und Ausbeutung geworden ist: neonerleuchtete Turnräume für den Drill des außereuropäisch Kreatürlichen. Für Martin Kasper sind es anschauliche Räume, die sich in zentralperspektivischer Perfektion darstellen lassen und gleichzeitig solche der Anschauung, die das Sehen selbst thematisieren: die Raumdarstellung ist Ausdruck dieser Inszenierung des Sehens. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Faszination des Künstlers für Kinos, Theater, Überwachungszentralen, Wartehallen und Foyers; sie alle dienen diesem Theater der öffentlichen Wahrnehmung. Mit ihrer komplexen Hintergründigkeit einer Raumdarstellung von gleichzeitiger Annäherung und Distanzierung ist die Malerei Martin Kaspers zu einer neuen Form der Historienmalerei geworden, die nicht mehr der Inszenierung von Personen in statischen Arrangements geschuldet ist, sondern die gravierendere Raumvergessenheit als historisch gewachsenen Faktor zu korrigieren versucht. Die Malerei Martin Kaspers sucht in dieser Korrektur den Raum als Politikum, als historische Größe und als gesellschaftlichen Faktor zum Ausdruck des Humanen von Handlungsweisungen werden zu lassen. Der Betrachterkörper in seiner politisch, kulturell und sozial bestimmten Erfahrungswirklichkeit ist immer selbst in und mit diesen Räumen gemeint, weil er deren in der Darstellung abwesender, aber in der Betrachtung anwesender konstituierender Bedeutungsfaktor ist. Im Grunde sind es lebendige Porträts.
Markus Schroer: Räume, Orte., Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums, Frankfurt 2006, S. 10 Markus Schroer a.a.O., S.164 Markus Schroer a.a.O., S. 164 Walter Benjamin: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, in: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Band I.2, Frankfurt 1991, S. 548 – 549.

Martin Kasper, ›Inside‹, Texte: Hans-Joachim Müller, Dietrich Roeschmann, hrsg: Christoph Merian Verlag, Basel, 2005
mehr»
mehr»
Im Ruhemodus
Zu den Bildern von Martin Kasper
Grünes Gewölbe. Schmucklos. Aus feudaler Zeit stammt es nicht. Zum Green Cube fehlt ihm die Winkeltreue. Also Zwischenzeit. Zwischen alter und neuer Zeit. Ein Raum mithin ohne Zeit und voller Zeit. Ein Raum, in dem man wartet, dass es Zeit wird.
Waren wir nicht schon dort? Kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Immer führen uns die Bilder von Martin Kasper an Orte, an denen wir schon gewesen sein könnten, wo uns alles bekannt vorkommt und zugleich alles fehlt für die Vertrautheit. Der Wartesaal – im Badischen Bahnhof in Basel – ist leer. Niemand da. Keiner, der wartet, dass es Zeit wird. Hat der Taktfahrplan das Warten überflüssig gemacht? Kein Zug mehr, auf den sich zu warten lohnte?
Wo alle warten, sind alle Opfer der vielen, der zäh vergehenden Zeit. Wo alle warten, sind alle Opfer der vielen, der zäh hängenden Blicke. Warteopfer sind Blickopfer. Jeder schaut dem anderen beim Warten zu, jeder schaut zu, wie ihm beim Warten zugeschaut wird. Das ist ein wenig peinlich. Peinlich ist auch, dass diese Opfergemeinschaft zwangsläufig erträgt, dass die Intimität des Wartens öffentlich geschieht. Was aber, wenn eine Opfergemeinschaft gänzlich fehlt, wenn auf Martin Kaspers Bild der Wartesaal leer bleibt? Dann ist diese Leerstelle wie ein Sog, in den man hineingerät und körperhaft spürt, wie es wäre, wenn man da sässe – und eben nicht allein da sässe. Ein Wartesaal-Bild mit Wartenden würde davon handeln, was ungemütlich ist an Raum und Zeit. Das Wartesaal-Bild ohne Wartende handelt von uns, von Widerstand und Widerstandslosigkeit, von der Faszination an leerem Raum und leerer Zeit.
Börse, Bowlingbahn, Konferenzhalle, Schaltzentrale, U-Bahn-Station, Gerichtssaal, Bar, Kino, Restaurant, Autogrill. Nie ist mit der Einladung in diese Bildräume Aufgehobenheit versprochen, angenehmes Unterkommen, nie Behüttung oder Behütung. Seltsam kalt erscheinen die Interieurs. Immer herrscht dieses kranke Licht, die labortechnische Ordnung, die Asepsis der Pathologie. Zum Wohlfühlen ist das nicht. Dazu erscheinen die Räume zu offen, zu weit aufgeschnitten. Irgendwo geht es stets weiter: nach links, nach rechts, nach hinten, nach oben, um die Ecke. Und selbst der hermetisch wirkende Saal der Broker und Börsianer ist nur Relaisstation unaufhaltsamer Kapitalflüsse. Es sind Bühnen für festgelegte Auftritte, eingerichtet für Kommen und Gehen, nicht für Ankommen oder Bleiben. Durchgangsräume – wie der Wartesaal.
Und doch ist niemand da, der käme oder ginge. Niemand, der auf seinen Auftritt wartete. Die wenigen Figuren gehören zur skulpturalen Staffage, sie bevölkern, beleben die Räume nicht. Die Frau in der U-Bahn-Station scheint den Luftzug kaum zu verspüren, der ihr die Mantelschösse auseinander bläst. Sie steht wie Säule oder Pfeiler, und wenn jetzt ein Zug vor ihr hielte, sie stiege nicht ein. Der Kellnerkopf hinter dem Tresen im Restaurant Alex bildet mit Tellerstapel, Gläserset und Lichtspot ein veritables Stillleben. Dass von ihm viel Handlung ausginge, wäre schwerlich zu behaupten. So wenig wie die Gäste im riesenhaften Bowlingcenter in irgendeine Spielhandlung vertieft scheinen. Niemand handelt, nichts geschieht auf diesen Bildern – ein seltsamer Kontrast zu den opulenten Zurüstungen für mögliche Handlung und Geschehen.
Leuchtkörper in Ufo-Dimension. Sessel wie Torsi. Stabstellen, als würde hier das Schicksal der Welt entschieden. Auf den ersten Blick scheint die überzeichnete Möblierung einer surrealen Tradition zu folgen. Und man meint, solche Kulissen gut zu kennen. Aber wenn man die Stücke benennen will, die hier spielen müssten, dann fehlen die unzweifelhaften Titel. Erinnert das Ambiente nicht an Hollywoods Wille und Vorstellung? Aus welchen Filmen stammt, was da im fahlen Licht wie Hauptquartier, Kommandobrücke, Kontrollstation, Steuereinheit oder Rechenlabor anmutet? Die Stimmung schwankt zwischen Raumschiff Enterprise und Weltvernichtungssalon à la Dr. No. Aber wer da was lenkt und leitet und Rettung oder Untergang beschliesst, das wird nicht verraten. Dass es um wichtige Dinge geht, um bedeutende Ereignisse, das scheint gewiss. Nur dass sich keiner zeigt, der Verantwortung übernehmen wollte, kein einsamer Held, keiner aus dem unsterblichen Titanengeschlecht.
Trocken, fast beiläufig wird das geheimnisvolle Nebeneinander der schieren Ereignislosigkeit und des pathetischen Ereignisvorscheins inszeniert. Wie ein dünner, fast transparenter Schleier liegt die Farbe auf der Leinwand, und nie gerinnt sie zu einer deckenden Haut. Nimmt man die Durchsichtigkeit als Zeichen eines reflexiven Vorbehalts beim Bildermachen, dann hat man zugleich ein Motiv für das ganze Werk. Malerei scheint nur noch möglich, wo sie sich ihrer Schritte und Teile bewusst bleibt, wo sich das Bild bei seiner Bildwerdung selbst begleitet. So – im Denkverhältnis zu sich selbst – darf sich Malerei auch noch einmal auf ihren alten sinnlichen Zauber verlassen und entdeckt ihre enormen Möglichkeiten, indem sie gerade nicht – wie noch die Avantgarden des 20. Jahrhunderts es taten – sämtliche neuen Bildtechniken simuliert.
Man kann Statik und Statuarik dieser Bilder, die gefrorenen Situationen, die Handlungsarmut auf entleerten Bühnen, diese blockartige Wucht der Dinge und Architekturen auch als malerische Strategie gegen die zeitgenössischen Beschleunigungen verstehen, gegen die Verflüchtigungen, die Instabilität, den hektischen Stoff- und Ideenwechsel, der aus einer innovationsgetriebenen Kultur resultiert. Malerei muss nicht neu sein, wenn sie souverän sein kann. Und was sich da so irritierend unbeschwert an der Tradition misst, sollte nicht missverstanden werden als Rückzug oder Verteidigung. Näher kommt man dieser Malerei, wenn man ihre Verzögerungen, Reduktionen, Schematisierungen zeichenhaft begreift, als ebenso überlegte wie überlegene Option gegen das virtuelle Phantasma dieser Jahre.
Ruhe auf der Bowlingbahn. Vertagung im Konferenzsaal. Handelsschluss an der Börse. Nichts los im Café. Martin Kaspers Stills sind nicht einfach angehaltene Filme. Sie sind inszeniert, mit künstlichen, künstlerischen Mitteln in den Ruhemodus gebracht. Willentlich vereinfacht, geometrisiert, entrümpelt. Nirgendwo Dekor. Alles fehlt, was überflüssig, was nur Beiwerk wäre. Kein vergessener Zettel im Hippodrom, in der U-Bahn-Station nichts auf dem Boden, blanke Tische im Restaurant, Theke ohne Kuchen, Bar ohne Flaschen. Als ob der Maler seine Räume erst einmal ausgeräumt, Leben und Lebensutensilien weggeschafft, an Tischen und Regalen die Beschläge demontiert und keine losen, formlos herumstehenden Gegenstände zugelassen hätte.
Soll man dazu Abstraktion sagen? Oder ist es gerade umgekehrt, findet hier eine zögerliche Wiedergewinnung von Gegenständlichkeit, behutsame Gegenstandssuche im Fundus der gegenstandsvergessenen Moderne statt? Sie weiss – und gerade darin erweist sich die Intelligenz dieser Malerei –, dass alle Schlachten schon geschlagen sind, dass es nichts mehr durchzukämpfen gibt, dass man sich nicht mehr auf die Seite des einen oder des anderen zu stellen braucht, weil alles nebeneinander Bestand hat, die Abstraktion und die Gegenständlichkeit, die Figürlichkeit und die Gestik, die Malerei und die aufgelösten Kunstformen. Sie weiss, dass das eine nicht für Fortschritt und das andere nicht für Rückschritt steht, und es keine medialen Anwälte mehr braucht, um vorzugeben, was an der bildhaft gewordenen Welt noch Anspruch auf Bedeutung erheben kann.
Die Grunderfahrung der Zeit ist die der inkommensurablen Verfügbarkeit. Alles liegt schon getan vor einem. Und wenn es auch nicht so ist, dass damit alle Rätsel gelöst und alle Geheimnisse gelüftet und alles Wissbare verstanden wäre, dann erlebt sich Bewusstsein, das keinerlei Utopien mehr verpflichtet ist, doch mitgerissen vom Strom der vermessenen Dinge und der unermesslichen Ereignisse. Und es behauptet sich, indem es da und dort andockt, dies und jenes besetzt, aussucht, verknüpft, kaleidoskopartig zusammenstellt, zum Netz aufspannt, aber nichts mehr aufzuhalten braucht wie die utopiegläubigen Generationen zuvor und nichts mit immer neuer Neuschöpfer-Grandiosität überbieten muss.
Alle Wege sind bezeichnet. Was ja nicht heisst, dass man nur noch den vorgespurten Pfaden folgen könnte. Noch immer gehört es zu den intelligenten Kulturtechniken, seine Wege selber zusammenzustellen. Trotz GPS. Das tritt mit keinem geringeren Anspruch an als mit umfassender Kenntnis aller Wegedaten. Und wer sich darauf verlässt, wird auch kaum sein Ziel verfehlen. Aber das bedeutet nicht, dass er gezwungen wäre, der Computerstimme zu folgen. Niemand verbietet ihm, Umwege zu fahren, seine eigenen Abkürzungen zu suchen. Er kann, wenn man so will, das GPS überlisten. Intelligente Malerei heute ist so etwas Ähnliches wie GPS-Überlistung. Mit List geht sie ihren Weg – mitten durch den Wahn der vollends erschlossenen Welt.
Welt, das sind die Bilder, die wir uns von der Welt machen. Sollte man bei Martin Kaspers Bildern sagen ‹gedämpfte Welt›? Ein wenig stumpf sieht diese Welt ja aus, trocken, leicht verschattet, entrückt, entfernt, durch ein opakes Okular gesehen. Und die Dinge erscheinen wie abwesend, nicht ganz hier zu sein, von weit hergeholt, aus der Erinnerung belichtet, festgehalten auf einem Film, der alle Töne nach Moll hin moduliert. Das schafft eine eigentümliche Stimmung. Aber die ‹gedämpfte Welt› ist kein romantisches Paradigma, kein Sehnsuchtsmotiv, indiziert nicht Traum oder Halbwachheit. Alles ist hier überaus bewusst. Keine Zufälle, nichts was einfach geriete, was wie von selbst so würde. Man muss das betonen, weil gerade die konstruierte Unschärfe das Zeitgenössische dieser Bilder ausmacht.
Malerei heute kann nicht mehr so tun, als ginge es noch immer darum, die Dinge einfach umzusetzen, sie von ihrem Dingsein in den Zustand des Gemaltseins zu heben. Sie weiss vielmehr, dass zwischen dem Dingsein und dem Gemaltsein immer schon das Bildsein ist, dass die Dinge nicht anders und nicht eigentlicher erfahrbar sind denn als Bilder. Auch Martin Kaspers gemalten Bildern gehen in der Regel fotografische Bilder voraus. Bilder aber existieren nicht in der stofflich begrenzten Form des Gegenstands mit festen Dimensionen und festen Bestimmungen. Bilder verweisen aufeinander. Sie sind immer zugleich Bilder von Bildern, existieren nur in der dynamischen Form der Referenz. Ihre Ränder verfliessen. Was zwischen den Rändern ist, bleibt vage, die Beziehung ist Unschärferelation. Das, nichts anderes meint die eigentümliche Unschärfe auf Martin Kaspers Bildern.
Wenn die Stopp-Signatur dieser Malerei – das zum malerischen Verhaltensmuster gehörende Anhalten, Leeren und Warten – als Metapher für Abständigkeit gelten darf, dann bietet solche Distanz eine doppelte Chance: für eine Neueinstellung der Sehschärfe und zugleich für die Wiederentdeckung der Dinge in der Unschärfe. Gerade im Abbau der Formen- und Dingfülle erlebt diese Malerei, wie die Formen und Dinge uneindeutig werden, magisch. Und dann thront der Bildschirm wie eine konstruktivistische Skulptur auf dem Sockel, und die futuristische Bar verwandelt sich in eine medizinische Apparatur und die U-Bahn-Station in ein Bühnenbild für ein melancholisches Einpersonenstück.
Und zum Schluss wird aus dem Einpersonenstück dann doch wieder ein Keinpersonenstück. Wie beim schmucklos grünen Gewölbe, von dem man nur sagen kann, dass es nicht aus feudaler Zeit stammt und ihm zum Green Cube die Winkeltreue fehlt. Mehr lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Es sei denn, man sagte es so unbestimmt, wie die Malerei im unscharfen Dazwischen bleibt, irgendwo zwischen alter und neuer Zeit. Wenn man es so sagen könnte, dann müsste man vielleicht sagen: Ein Raum, in dem niemand wartet, weil es längst Zeit geworden ist.
Hans-Joachim Müller

›Malerei Jetzt‹, hrsg: Bernd Künzig, Bühl, 2006
mehr»
mehr»
Martin Kasper: Der Raumfahrer
In jüngster Zeit hat die wissenschaftliche Kritik verstärkt auf die Raumvergessenheit hingewiesen. Der Soziologe Markus Schroer hat mit einer grundlegenden Untersuchung sich bemüht, an einer „Soziologie des Raums“ zu arbeiten und dabei einleitend auf ein grundlegendes Paradoxon aufmerksam gemacht: „Auf der einen Seite ist der Raum sehr konkret, da er uns ständig zu umgeben scheint, wir uns ständig ‚in‘ ihm aufhalten. Wir können Raum erfahren, können Räume begehen, betreten und wieder verlassen. Auf der anderen Seite ist der Raum äußerst abstrakt. Können wir uns unter ‚Lebensraum‘ noch etwas Konkretes vorstellen, scheint schon der ‚Weltraum‘ nicht mehr recht fassbar, weil er sich in seinen unendlichen Weiten und seinen immer noch expandierenden Ausmaßen unserer Erfahrung entzieht. Schon Pascal notiert angesichts dieser Unermesslichkeit des Raumes: ‚Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.‘“ Dieses Pardoxon und das Erschrecken vor dem Schweigen treibt den Maler Martin Kasper mit seinem bildkünstlerischen Schaffen um. Innen und Außen stehen sich in solch obsessionellem Tun dialektisch Gegenüber. Die sorgfältige Malerei, die sich der handwerklichen Tradition der Tempera-Technik bedient, bedarf des geschlossenen Atelierraums, um in diesem Innen als Verinnerlichtes das auf der Leinwand zu bannen, was als Erfahrung im Außen gemacht wurde. Denn Martin Kasper ist ein irdisch verhafteter Raumfahrer, dem es keinesfalls genügt, von fotografischen Vorlagen zu zehren. Seine Raumdarstellungen basieren in der Regel auf konkreten Erfahrungen und Recherchen in der Urbanität verschiedenster Metropolen. Die Erfahrungen, die sich in der malerischen Darbietung von U-Bahn-Stationen, Wartehallen, Foyers, Kinos, Theatern, Überwachungszentralen oder Fernsehräumen niederschlagen, gerinnen zu schweigenden Räumen, die dennoch auf Gebrauchszusammenhänge des Sozialen, Politischen und Kulturellen verweisen, wenngleich sie zögernd als humane Aktionsräume dargestellt werden. Nur recht verhalten und verstärkt erst in den letzten Jahren ist die menschliche Figur in diese Raummalerei eingezogen. Und dennoch: es handelt sich um Bühnen des Gesellschaftlichen. In den jüngsten Arbeiten, die sich mit Affenhäusern verschiedener Zooanlagen befassen, sind sowohl Tier und Mensch wieder verschwunden. Gerade derartige Räume sind fundierte Inszenierungen der Beziehung von Mensch und Welt. In ihnen schlägt sich jener abgründige Umgang mit dem fremden Außen nieder, das nun heimgeholt zu einer unterkühlten Inszenierung der zivilisatorischen Aneignung und Ausbeutung geworden ist: neonerleuchtete Turnräume für den Drill des außereuropäisch Kreatürlichen. Für Martin Kasper sind es anschauliche Räume, die sich in zentralperspektivischer Perfektion darstellen lassen und gleichzeitig solche der Anschauung, die das Sehen selbst thematisieren: die Raumdarstellung ist Ausdruck dieser Inszenierung des Sehens. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Faszination des Künstlers für Kinos, Theater, Überwachungszentralen, Wartehallen und Foyers; sie alle dienen diesem Theater der Wahrnehmung. Wenn Martin Kasper sich in seiner „Tribunal“-Serie mit Porträts von Richtern, Zeugen, Anwälten und Angeklagten des Kriegsverbrecherprozess um den ehemaligen Serbenführer Slobodan Milosevic auseinandersetzt, dann umkreisen diese Darstellungen der menschlichen Figur in ihren sozialen und politischen Rollen erneut einen Raum, der ihre Handlungen und ihre daraus resultierenden Abbildungen im Porträtieren von Haltungen, Gesten und Gesichtsausdrücken begründet. Dies ist jener Gerichtsaal des internationalisierten Tribunals, in dem Geschichte und Verbrechen zu einem durchorganisierten, rationalisierten kühl inszenierten Akt des Aufarbeitens geworden ist. Mit dieser komplexen Hintergründigkeit einer Raumdarstellung von gleichzeitiger Annäherung und Distanzierung ist die Malerei Martin Kaspers zu einer neuen Form der Historienmalerei geworden, die nicht mehr der Inszenierung von Personen in statischen Bildern geschuldet ist, sondern die gravierendere Raumvergessenheit zu korrigieren versucht. Die Malerei Martin Kaspers sucht in dieser Korrektur den Raum als Politikum, als historische Größe und als gesellschaftlichen Faktor zum Ausdruck des Humanen von Handlungsweisungen werden zu lassen. Der Betrachterkörper in seiner politisch, kulturell und sozial bestimmten Erfahrungswirklichkeit ist immer selbst in und mit diesen Räumen gemeint, weil er deren in der Darstellung abwesender, aber in der Betrachtung anwesender konstituierender Bedeutungsfaktor ist.

›Flashback‹, hrsg: Dorothea Strauss, Kunstverein Freiburg, Freiburg, 2005

›Painting on the Move‹, hrsg: Bernhard Mendes Bürgi, Peter Pakesch, Basel, 2002
›Zeitgenössische Kunst am Oberrhein‹, hrsg: Stadt Offenburg, Franz Huber Verlag, 2001

›Abbild, recent portraiture and depiction‹, hrsg: Peter Pakesch, Springer Verlag, Wien, 2001

Martin Kasper, ›Treibstoff‹, Text: Ralf Beil, hrsg: Galerie Daeppen und Galerie Schwarz, 2000
mehr»
mehr»
Treibstoff oder: Die Macht der Farbe Ralf Beil In: Katalog der Ausstellung in der Kunsthalle Bremerhaven
Was verbindet das Trinkwasserreservoir einer kanarischen Insel mit einem Rhône-Kraftwerk und einer Tankstelle im Breisgau? Es ist Martin Kaspers Malerei. Für einige Zeit vereinigt in der Einzelausstellung der Kunsthalle Bremerhaven, beweisen seine Bilder wieder einmal, daß Kunst im besten Fall immer schon das Ereignis einer neuen Perspektive ist. Martin Kasper selbst spricht von "Malanlässen", wenn die Rede auf seine Motive kommt. Der 1962 im schwäbischen Schramberg geborene Maler lebt und arbeitet in Freiburg, doch er braucht regelmässig Streifzüge und ausgedehntere Reisen, um sich mit dem Basismaterial seiner Kunst zu versorgen. Kameranotizen von Architektur in Landschaft - "Rohphotos", wie Kasper es ausdrückt - bilden die Grundlage seiner malerischen Recherchen, an dessen Ende Realitätskonzentrate von eindrücklicher Intensität stehen. Paradigmatisch für diesen künstlerischen Destillierungsprozess ist die Leinwand "Flughafen", entstanden im letzten Jahr. Fasziniert von der strengen Glasarchitektur vor sanftem Hügelhorizont, die er bei der Landung auf der Insel Teneriffa vorfand, hat der Künstler binnen Minuten vom Rollfeld aus eine ganze Anzahl Photos geschossen. Später, zurück im Atelier, hat dann die eigentliche Arbeit begonnen: Kasper hat das ausgewählte Motiv von allem berflüssigen, jedem nicht wesentlichen Detail geschieden, es von jeglichen Fahr- und Flugzeugen sowie Menschenansammlungen geleert. So ist am Ende von dem emsigen Touristenumschlagplatz nurmehr ein strenger Gebäuderiegel übriggeblieben, der scharfkantig den Landschaftsprospekt zerschneidet und zugleich dessen Kraftzentrum ist. Die seltsame Spannung, die von diesem Kasper-typischen Querformat ausgeht, wurzelt nicht nur in der pointierten Frontalität des Gebäudes sowie der Leere des Bildes, sondern auch in der eigentümlichen Kargheit der Temperamalerei selbst. Ähnliches könnte man auch von der Leinwand "Sassnitz" sagen, deren kühner Komplementärkontrast sich weder in den ursprünglichen Kameranotizen noch in Goethes "Farbenlehre" im Atelierregal findet. Machtvoll trifft mattiertes Pariserblau und Türkis auf latent giftiges Gelb, umso machtvoller stösst die Landungsbrücke auf der Kaimauer ins schwefelfarbene Nichts vor. Seit 1995 visualisiert Martin Kasper solche Orte gespannter Ruhe und kurios energetischer Aura. Bis vor kurzem kamen vor allem Kaliminen, Hebewerke, Schleusen, Stauseen und Wasserkraftwerke ins Bild. In jüngster Zeit nun hat er insbesondere den "Malanlass" Tankstelle für sich entdeckt. Nur ein Maler hat vor Martin Kasper Tankstellen derart prominent zum Bildmotiv erkoren: Edward Hopper. Doch wo Hopper mit seiner "Mobilgas-Station" atmosphärisch die Einsamkeit des archetypischen Vorpostens amerikanischer Zivilisation auf die Leinwand bannt, interessiert Martin Kasper etwas ganz anderes. Bei aller Möglichkeit zu atmosphärischer Verdichtung, wie sie sich etwa in "T 10" manifestiert, wo der Gebäuderumpf der Tankstelle unter tristem Graublau mit seinen Fensterschlitzen regelrecht zu äugen beginnt: Martin Kaspers "Tankstellen" sind - wie "T 9" und insbesondere "T 11" belegen - primär Farb- und Formereignisse, die, per se stark gegliedert durch horizontale Lichtbänder und Farbstreifen, in ihrer massiven Frontalität und monumentalisierenden Totale unweigerlich zu bildnerischer Abstraktion tendieren. Nur auf den ersten Blick mag es verwundern, dass Kasper, befragt nach Malern, die ihn derzeit besonders beschäftigen, ausgerechnet Kasimir Malewitsch und Rupprecht Geiger nennt. Je länger man sich mit seinen neuesten Werken auseinandersetzt, umso schlüssiger wird die Wahl des Künstlers. Dürfte ihn an Geigers Werken die geradezu körperliche Intensität der Farbe reizen, so sind es bei dem grossen Russen insbesondere die nachsuprematistischen Streifenbilder, die mit Realitätszitaten arbeiten, diese aber gekonnt formalisiert im Schwebezustand zur Abstraktion halten. Der "Malanlass" Tankstelle hat Martin Kaspers Malerei grundlegend verändert. Wie sehr, dass lässt sich an seinen Bildern von Kraftwerken und hochalpinen Betonbauten aus den Jahren 1997 und 1998 ablesen: "Rhône 3" etwa oder "Brenner". Zwar beherrschen auch dort Totale und Horizontale die Komposition, doch hat diese Malerei der spröden Leimfarben in ihren verhalten tonigen Valeurs und atmosphärischen Hell-Dunkelkontrasten einen ganz eigenen Reiz. In Martin Kaspers Werdegang sind sie heute fast schon "klassisch" zu nennen. Auch wenn sich die "Tankstellen"-Serie im Vergleich dazu noch mitten in ihrer Entwicklungsphase befindet, so zeichnet sich bereits jetzt ein eminenter Gewinn für den Künstler ab: Fest steht, dass Martin Kaspers Erkundungen auf dem Terrain der Farbe ihn in noch unerforschte Gebiete seiner Kunst zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, detailgenauem Realismus, abstrahierender Unschärfe und roh belassenen Leerstellen geführt haben. Fest steht ferner, dass dies sein ganz eigener Beitrag und zugleich Ausweg aus der Malereidiskussion unserer Tage ist. Mögen die puristischen Positionen von Realismus und Abstraktion längst zum Klischee oder blossen historisch-ironischem Zitat verkommen sein und als Extremwerte der Malamplitude nicht mehr befriedigen - dazwischen gibt es noch immer genug Welten zu entdecken. Martin Kasper hat seine Personale in der Kunsthalle Bremerhaven "Treibstoff" genannt. Man mag es durchaus auf die kaum zufälligen Ausgangspunkte seiner malerischen Recherche beziehen - auf Flughafen, Kraftwerk oder Tankstelle, allesamt Passagenorte, Relaisstellen technisch-mechanischer Bewegung, Treibstoffbasen im eigentlichen wie bertragenen Sinn. Wichtiger scheint mir jedoch die energetische Bedeutung des Begriffs für ihn selbst. In der Kunsthalle Bremerhaven hat Martin Kasper zum ersten Mal öffentlich vorgeführt, was er im letzten Jahr als eminenten "Treibstoff" für sich entdeckt hat: die Macht, ja Opulenz der Farbe.
›Regionale 2000‹, Text: Peter Pakesch, hrsg: Peter Pakesch, Kunsthalle Basel, 2000
›Malerei aus Baden-Württemberg‹, hrsg: Künstlerbund Baden-Württemberg, 1999

Martin Kasper, ›Kraftwerke‹, Text: Siegmar Gassert, hrsg: Ausstellungsraum Büchsenhausen, Innsbruck,1997