
Martin Kasper im Wasserschloss Glatt, ›Vertigo‹, text: Hans-Joachim Müller hrsg: Bernhard Rüth, Modo-Verlag, Freiburg http://modoverlag.de »
more»
more»
Umbau
Die neueren Bilder von Martin Kasper mit den älteren zusammengesehen
Hans-Joachim Müller
Als hätte man geklingelt, und der Maler hätte geöffnet, die Vorhänge weit aufgezogen, und man stünde nun vor „Saal“, „Halle“, „Korridor“, „Space“, „Passage“. Und niemand da. Und alles ausgeräumt. Funktionslose Leere. Stilles Raumtheater. So ist es immer bei Martin Kasper. So ist es immer beschrieben worden. Und auch heute ist es noch so. Und ist doch ein bisschen anders.
Vor Jahren haben einen die Bilder irgendwohin geführt - an Orte, die es vielleicht gibt oder auch nicht gibt, die man so oder ähnlich schon mal gesehen zu haben meint. Es war wie eine Einladung zum behutsamen Verharren vor Sälen und Hallen, deren architektonischer Stolz sichtlich gelitten hat. Die Zeit muss durch sie gefegt sein, als hätten jahrelang die Fenster offen gestanden. Von Leben keine Spur mehr - oder eben doch lauter Spuren rätselhaft abgetanen Lebens. Dann und wann auch mal Figurenschemen, die wie platonische Schatten an irgendeine Tätigkeit erinnern, ohne wirklich da zu sein. Und wenn Martin Kasper auch nie Geschichten erzählt hat, dann ging die Faszination vor seinen Bildern nicht selten mit klopfendem Herzen einher. Als im Jahr 2013 Marion Poschmanns Roman „Die Sonnenposition“ herauskam, und man mit leichtem Gruseln dem „rundlichen Rheinländer Altfried Janich“ ins verfallene „Ostschloss“ folgte, wo er in der Psychiatrie seine albtraumhaften Tage und Nächte erlebt, da schien es fast zwingend, an Martin Kaspers Bilder zu denken, die sich einem bei der Lektüre wie Kulissen vor die Sinne schoben.
Noch immer spielt alles drinnen. Dass der Maler rausginge, sich draußen umsähe, das kommt nicht vor. Nie steht er am Fenster wie Goethe in seiner römischen Wohnung am Corso, oder wie Adolph Menzel sein Balkonzimmer malt, durch dessen Fenstertüren der Tag wie ein sonniges Versprechen hereinweht. Martin Kaspers Fenster, wenn es sie denn gibt, sind blind. Er übernimmt sie als Zeichen für die Raumkonzepte der Moderne, die allesamt den umständelosen Blick durchs Bildfenster zur Welt verstellen. Denn bei allen blinden Flecken, die diese Moderne selber produziert hat, hat das doch zu ihren hellen Erkenntnisbeständen gehört, dass die wahren und die unwahren Bilder alle auf der Netzhaut entstehen unter tatkräftiger Hilfe benachbarter Hirnlappen. Vergeblich die alte Hoffnung, man bräuchte nur die Fenster der schönen Bildillusion zu öffnen, um noch einmal die sichtbare Welt wahrheitsgemäß abzubilden. Solches Zutrauen ist im Mahlwerk der Avantgarden gründlich zerrieben worden. Und so sind auch Martin Kaspers Fenster bis heute geschlossen geblieben.
Aber das Drinnen ist sichtlich komplexer geworden. An der Frontalität hat sich nichts geändert, und auch die wahrnehmungstechnische Opposition - hier starrer Betrachter, dort starre Raumbühne - gilt noch immer. Oder vielleicht nur vorerst noch. Denn die Offenheit der Architekturen scheint längst nicht mehr so ohne Weiteres gewährleistet. Manches mutet jetzt verstellter an, verschachtelter. Nicht selten irrt der Blick umher, findet keinen Halt in der undurchschaubaren Logik der Vorhallen, der Flure, der Treppen-Auf- und Abgänge. Auch erscheinen die Räume auf ein tiefes Hinten konzipiert, münden in unübersichtlichen Korridoren, verlieren sich in unendlichen Fluchten - wie in Großflughäfen, in denen man auf kilometerlangen Rollbändern sein irgendwo in der Ferne liegendes Gate ansteuert. Oder in der Metro, wenn man beim Umsteigen an den Kreuzungsstationen durch die gekachelten Röhren hetzt.
Kafka fällt einem ein. „Der Prozess“, dessen ungemeine Suggestion mit dem halluzinierenden Raumerlebnis des schuldig unschuldigen Delinquenten K. zusammenfällt, der sich zögerlich wie im Traum, in dem man nicht von der Stelle kommt, dem Haus nähert, in dem der Untersuchungsrichter auf ihn wartet: „Das Haus lag ziemlich weit, es war fast ungewöhnlich ausgedehnt, besonders die Toreinfahrt war hoch und breit. (…) K. wandte sich der Treppe zu, um zum Untersuchungszimmer zu kommen, stand dann aber wieder still, denn außer dieser Treppe sah er im Hof noch drei verschiedene Treppenaufgänge und überdies schien ein kleiner Durchgang am Ende des Hofes noch in einen zweiten Hof zu führen.“
Das könnte auch eine Bauanleitung für den Innenarchitekten Martin Kasper sein. Und ob Untersuchungszimmer oder nicht, es sind Räume mit starkem Sog. Das hat sie schon immer ausgezeichnet. Jetzt kommt einem die Schwerkraft, die einen vor den Bildern hält, fast wie ein Rätsel vor. Eigentlich müsste man angesichts der Energie der Arrangements wie von schwarzen Löchern verschlungen werden. So mischt sich in das psychische Erlebnis ein eigentümlich physisches, in die bedenkende Anschauung ein wunderliches Körpergefühl. Zumal diese Räume mit mancherlei ortsfremdem Inventar besetzt sind. Da und dort Stellwände, farblich abgesetzte Einbauten, als seien Kulissenteile verschiedenster Theaterstücke verschränkt und zusammengeschoben worden.
Und nicht weniger irritierend ist, wie die gemalten Bilder mit den Räumen, in denen sie auftreten, unübersehbar interagieren. Wie die Malerei hier in der Ausstellung im Wasserschloss Glatt Raumelemente zitiert, verfremdet, die noble Anmutung des Galerie-Westflügels aufgreift und sie bildnerisch reproduziert. Tatsächlich gewinnt jetzt die Bild-im-Bild-Idee, das alte Mise-en-Abyme-Verfahren eine neue und bestimmende Rolle. Es ist, als sei man eingeklemmt zwischen einem Spiegel vor einem und einem Spiegel im Rücken, in denen sich unser Spiegelbild unendlich vervielfältigt. Und so ist man unversehens zum Raum-Insassen geworden. Man steht nicht mehr einfach vor dem Bild und wahrt seinen Sicherheitsabstand und schaut wie im Theater auf die Bühne. Plötzlich ist man mitten im Stück selber.
Beim Großbild, das den lakonischen Titel „Halle“ trägt, könnte man an eine Messe-Koje denken mit verwirrenden Spiegelungen und ins Monochrome spielenden Farbteppichen an den Wänden und auf dem Boden. Überhaupt muss die Zunahme des Malerischen auffallen. Die dominanten Farben auf diesen Bildern sind nun nicht mehr nur die Lokalfarben. Es sind kultivierte Blitze, die da und dort aufleuchten und unversehens aus der Form geraten können. Dann lösen sie sich gestisch auf, als probten sie ihre Tauglichkeit für das informalistische Fach. Und mehr und mehr scheint sich die gewohnte Raum-Solidität in Samplings der verschiedensten Seheindrücke zu verwandeln.
Besonders eindrücklich lässt sich das an dem mit seinen vier Metern Spannweite ausgreifenden „Diptychon“ beobachten, das die bis dato an der rechtwinkligen Geometrie justierten Linien in einen Strudel verwandelt, der wie Wellen durch die unklaren Raumabteile spült. Im Wortsinn ist das Bild-Paar zum Zerrbild geworden, das fast alles, was es „drinnen“ zu sehen gibt, verbiegt und verbeult: Die Wände die reinste konkave Zumutung, die Bilder verquirlte Hard-edge-Malerei, die Türstürze wie mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommen. Dazu schweben Teile einer monströsen Ritterrüstung in der seltsam erregten Formlosigkeit, die sie umgibt, wie im schwerelosen Raum. Was soll man sagen? Ein manifester Aufstand der Dinge gegen das Schicksal, das ihnen der euklidische Raum aufnötigt.
Das „Diptychon“ könnte auch „Vertigo“ heißen. Denn es ist nichts weniger als Schwindel, Taumel, in den man da gerät. Was der Grund sein könnte, wird nicht verraten. Vielleicht ist es ja nur eine Spiegel-Laune. Aber auch dann wüsste man gerne, wo das mentale Epizentrum liegt, das die Bildgegenstände im Bildraum mit derartigen Energien versorgt. Energien, unter denen der konstruktive Halt, von dem Martin Kaspers Bilder stets in dem ihnen eigenen Rätselton berichtet haben, zu bersten droht. Irgendwie herrscht stiller Aufruhr. Nicht Splatter-Logik. So wenig wie früher der Halt soll jetzt der Zerfall bewiesen werden. Die Malerei will freier werden, so ist es. Sie will sich ihre Sensation nicht mehr in erster Linie von der Raum-Atmosphäre diktieren lassen. Inzwischen kann man auf diesen Bildern Partien entdecken, die sich in ihrem farbgestischen Duktus unübersehbar abgrenzen oder ausgrenzen und auch nicht mehr Bilder an der Wand, also bildinterne Bildgegenstände sind, sondern wie flächige Applikationen den verbliebenen Raumhintergründen eingeschrieben, eingemalt sind, ihnen innewohnen.
Der Maler hat die Tarkowski-Stimmung, die von seinen verlassenen Innenräumen ausgeht, nie abgestritten, aber mit nicht weniger Nachdruck hat er auf dem Primat bildnerischer Überlegungen beharrt. Und die Rolle des gegenständlichen Malers hat er nicht leugnen müssen, um deutlich zu machen, dass sie ihn nicht vollends ausfüllt. Es war immer riskant, wenn man Martin Kaspers Bildern allzu viel erzählerisch psychologische Raffinesse unterstellen wollte. Was Raffinesse an diesen Räumen ist, ist die Beziehung dysfunktionaler Formen, der untergründige Bezug formaler Elemente, die ihre Herkunft aus der dinglichen Welt nicht verschleiern, aber zur dinglichen Welt nichts wirklich beizutragen haben, die unzuständig scheinen für jeden plausiblen Kommentar. Aufs Ganze gesehen gibt sich der Maler auf eine sehr entschiedene Weise unentschieden: Er ist geradeso Bühnenbildner wie Formalist, dem die gegenständliche Welt immer auch Matrize farbkonstruktiver Systeme ist, die sich sorgsamer Planung und skrupulöser Entwürfe verdanken. Und wenn auch bei Martin Kasper die Regie des Unbewussten nie ganz auszuschließen ist, dann ist es ihm doch um Bilder zu tun, auf denen nichts der Laune überlassen bleibt, die vielmehr Stück um Stück gebaut sind und uns mit ihrer ausgeklügelten malerischen Organisation erreichen wollen.
Ganz verwunden hat es die avantgardistische Moderne ja nie, dass den Bildern die lästige Mimesis nicht vollends auszutreiben war, und die Gegenstände immer wieder triumphal zurückgekehrt sind. Dass der aufgeklärte Zeitgenosse polyglott zwischen den Kunstsprachen hin und her geschaltet hätte, zwischen Idee und Abbildung, Entfaltung und Darstellung, Erlösung von der Erzählung und Gebundenheit an die Form, es war immer nur eine freundliche Hoffnung. Tatsächlich ging es um Parteinahme und Widerstand, um Bewahren und Überwinden, um Anwaltschaft für die verlorene und Einsatz für die zukünftige Sache. Martin Kasper hält sich mit wunderbarer Unbeirrbarkeit aus der nie vollends abgeklungenen Polemik heraus. Das eigentümliche Kolorit seiner unbewohnten oder unbewohnbaren Räume, die abstrusen Widersprüche zwischen abgelebter Pracht und manifester Nutzlosigkeit, die Spannung aus Fülle und Nichtigkeit, die Waage zwischen den wahrscheinlichen und den unwahrscheinlichen Anteilen, die Suggestion der patinierten Leere, der Stillstand zwischen bildnerischer Gegenwart und Vergangenheit - das alles induziert eine existenzielle Mischung aus Gesehenem, Vermitteltem, Erinnertem und Erfundenem. Und angesichts des virtuosen Schwankens zwischen Capriccio und Vedute wäre es schon immer unsinnig gewesen, dieses Werk bloß als Beitrag zur Phantasiegeschichte des Interior Designs zu verstehen.
Wobei es keine Rolle spielt, woher die gegenständlichen Anregungen stammen. Der Maler kann dazu immer etwas sagen und macht aus der Herkunft seiner Impulse auch kein Geheimnis. Das Entscheidende aber ist doch, dass es Bilder sind, die er in seine Bilder einbezieht. Der Helm mit zugeklapptem Visier, der so mächtig die linke Bildhälfte bestimmt und mit seinen spiegelnden Krümmungen für die Torsionen der Raumarchitektur verantwortlich sein könnte, hängt nebenan als gemaltes Ungetüm an der Wand. Es ist - das wird gerade an dem neuen Zweiteiler erkenntlich - Malerei, die sich in erster Linie auf Malerei bezieht. Und dazu ist auch kein Widerspruch, dass an all den Kasper-Räumen Erlebnis und Anschauung geradeso zielführend mitgestaltet haben wie Gedächtnis und Gestimmtheit. Was zuletzt im Atelier geschieht, ist hoch reflektierter Ausgleich zwischen den bildnerischen Ideen und den bildnerischen Notwendigkeiten.
Nicht selten spielt auch eine auf ihre technische Wucht reduzierte Moderne mit, die sich nicht stört daran, dass ganz nachbarschaftlich Stuckleisten die Decke einfrieden und Protzlüster oder Beleuchtungskörper im Stalin-Pomp hängen. Alles gibt es eben: Die Diner-Unwirtlichkeit und das Konferenzzimmer der sechziger Jahre, den Festsaal à la Realsozialismus und die futuristische Kommandozentrale und das Kino ohne Programm, die Vorstadtbühne, auf der schon lange keine Heimattruppe mehr ihr Dorfpublikum empfing, und die seltsamen Kompartimente, die eine Bühnenbildnerin wie Anna Viebrock für eine Marthaler-Inszenierung entworfen haben könnte. Und wer will, darf angesichts des Verlassenheits- oder Aufgelassenheits-Charakters der Kasperschen Räume auch an Edward Hopper denken. Nur dass Hopper aus seinen atmosphärischen Motiven eine Art ikonischer US-Erzählung schafft, während Martin Kasper viel eher an den diffusen Eindrücken interessiert ist, am Verwirrspiel, an der Auflösung der vermeintlichen Einheitlichkeit, am Bau, der sich erst eigentlich beim Umbau bewährt.
Man kann in diesem Werk nicht von einem Bild aufs andere schließen. Das macht die Begegnung mit ihm so verblüffend und so spannend. Man könnte zwar längst mit Bestimmtheit von den Bildern auf ihren Autor schließen - das Bildklima ist unverwechselbar, und doch setzt sich der Film nicht einfach fort. Gerade jetzt, so scheint es, eilt er wieder einmal in einer überraschenden Wende auf und davon. In welche Richtung, wir werden sehen.
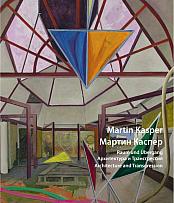
Martin Kasper, ›Architecture and Transgression‹, Text: Herbert M. Hurka, hrsg: modo-Verlag, Freiburg, 2017 http://muar.ru/en/exhibitions-events/exhibitions »
more»
more»
catalogue for the exhibition ›Architecture and Transgression‹ in Schusev State Museum of Architecture, Moscow june 22-july 30, 2017
Herbert M. Hurka Spaces of the outer and inner world On Martin Kasper’s architectural models
Public spaces are anonymous, and planned for specific purposes. Public offices, theaters, ballrooms or swimming pools only come to life during their opening times or for special events. The rest of the time they are deserted, and simply themselves. For 15 years Martin Kasper has focused on painting views of such places. The pictures primarily stand out for their sensitively elaborated interiors, richly detailed decoration, and special interior design features, but on a sub-textual level the enfilades, high ceilings and glazed fronts on Kasper’s paintings are to be read as paradigms of non-occupation. While initially Kasper RG felt attracted in his earlier paintings by the architectural styles of the 1950s and 60s, meanwhile his painting is developing along the same lines as the inexorably altering appearance of urban habitats. Works such as “Halbrund” (Semi-Circular) or “Schwimmbad” (Swimming Pool) are still very much inspired by the empirical buildings the artist looks for in every city he stays in. They are captured as photos, sketches are drafted, while the actual act of painting is relegated to the third phase. And by then the theme literally alters under his hands. Something added here, something omitted there, the flight lines, angles, arches, curves, fall of light and proportions are manipulated. While at first sight these rooms still appear realistic, on closer inspection it soon becomes apparent that their original architecture and laws of construction have been alienated to create structures suiting the requirements of the painting, and the many shifts merge into an artificial composition revealing a subjective spatial concept. Something else these rooms reveal: a room is never to be had as a whole, but rather our perception breaks up the spaces, which explains why the one visually homogeneously room is no more than idealization and phantasm. It is from this vacant state that Kasper peels away the individuality of a locality in order to paint portraits of rooms – as he describes it. This interpretation proves to be more than justified given that any portraitist to be taken seriously does not simply present the visible surface of his subject, but always also reveals character traits. Ever since Immanuel Kant defined space as a kind of observation, spatial perception and experience have shifted towards the subjective, and have become established as cognitive spatial concepts. A painting that addresses this opens up a wide variety of realizations. Alone the geometrical substrate comprising straight lines, angles and arches offers an inexhaustible resource for formal evolutions as found in “Macdo” and “Pong 2”. When triangles separate themselves from their surroundings as color surfaces, beams and window bars take on a life of their own as a network of graphic relationships or rotating and intertwining colored circles, such formal approaches serve much less to objectivize an internalized spatial concept, but rather to create circumstances intrinsic to the image for counteracting the conventional perceptual scheme comprising stable parameters like floors, walls and ceilings with abstract-constructivist forms. En passant, gaps in the interior design can be used for pictures within a picture. The art-historical expansion of the context corresponds with the media-specific expansion in the cited “Cicada” by Jasper Johns. When picture space such as “Macdo” and “Pong 2” mutate into stages for autonomous forms, they give rise to various options with surprising shifts of complexity. What is constructed can also be deconstructed at any time, and where would the paradigm of construction be more evident than in buildings? At any rate, the caved-in paneled wall in “Baracke” (Shack) can still be seen in the realm of something that actually exists. In the destruction of a building made over to itself and erosion, and whose original purpose is no longer recognizable, one falling panel is distorted into an absurd fan, while the weathered but still reasonably intact wall cladding hangs down from the ceiling in its former parallel arrangement. Whatever might seem realistic in this morbid scenario is negated by the coloring of the open landscape in the background, which is painted in such an artificial magenta that it only bears a passing resemblance to a sunset fitting for the subject. Completely deconstructed and shifted to the unreal is the composition of a round ceiling tower, which appears to be supported by a metal frame encircled with planks – a structure that is itself encircled by a landscape. Even though the title “Panorama” ought to clarify the optical properties because it was originally a trompe-l’oeil painting, which as a panoramic image produces a 3D illusion dating back to the 18th century, Martin Kasper pulls off the trick of even reducing this optical illusion to a second degree illusion. In this spatial spectacle it is only at second glance that the divides fall between interior and exterior so that the subtle impression of a dream scenario comes to mind, which is reinforced by the sloping surfaces of a central pedestal. Such panoramic images, once a mass media, but which had disappeared into the oblivion of media history, are experiencing an unexpected revival with the invention of the Japanese sweep-panorama camera, and also achieving a new popularity through the visualization of digital animation on screens or curving projection surfaces. With his awareness for current media developments and visual high-tech methods Martin Kasper insists on the still resistant medium of painting and responds with an artistic virtuosity, which can hardly be communicated using electronic techniques, because an invisible technique ousts the human, in particular the physical part of the production. Even though the painting titles are “Istanbul”, “Athens” or “Sofia” these subjects from another body of work are anything but tourist impressions. On the contrary. Rather than allowing observers to sensually experience the cities in question through their sights or other typical aspects in the manner of a traditional travel painting, Kasper comments – and does so with a touch of sarcasm – on the run-down ambience of contemporary metropolises. What is depicted on these city paintings does not deserve either a name or a reference to the location: abandoned places, dilapidated buildings like warehouses, open stockrooms and, it is no coincidence that we have an underpass as in the strangely red “Sofia”. Here the subtle color spectrum is compensated for using diverse light effects, while the graphic and compositional elements of concrete lumps (“Sofia”) or intrusive metal struts, not to mention the remnants of an air-conditioning system (“Athens”) intensify the inhuman atmosphere. While the official spaces of earlier paintings could still be interpreted as deserted non-places in the sense of French sociologist Marc Augé, who distinguished shopping malls, railway stations and swimming pools from living spaces owing to their mono-functional nature and lack of history, by contrast Martin Kasper explicitly selects for this body of work inhospitable places, with the technical execution being adapted to the subjects. Rather than the fine brushstrokes that characterized the earlier paintings generous spatula textures now dominate. Their cracked surfaces correspond with the concrete surfaces portrayed, just as the hard edges of the fractures reflect a ravaged looking building fabric. The rawness of the subject is mirrored in the rawness of the artistic form. Above – below, front – back, right – left: these adjectives describe the spatial coordinates employed to find your way about using the locomotor system and sensory organs. Martin Kasper’s paintings also follow an orientation system –central perspective. Although it is a trained cultural technique spatial perception using central perspective has long become second nature to us. Simultaneously, the internalized spatial data also structure the psyche so that interior and exterior continually overlap and result in what is occasionally an unresolvable sense of reality, which precisely a subject like “Panorama” visualizes in an exemplary manner. In addition, these conditions are underpinned by an underlying anthropological structure, which is founded in the natural defenselessness of the human body. Since Homo sapiens first left the security of the caves behind him and began to create a strong protective base, sometimes tantamount to armor, employing all manner of construction materials, he has applied himself to the phenomena of construction and building. Ancient myths like that of the tower of Babylon or the Cretan labyrinth testify to this, and can still be seen in the more recent philosophical broodings of Gaston Bachelard, who in his book “Poetry of Space”, explores the phenomenology of the house. Freud goes further still, when he divides the subject according to the metaphor of the house, by which the basement symbolizes the unconsciousness, the beletage the ego and the attic the superego. As such, it not coincidental by any means, when in image of the house the borders between concrete perception and projection dissolve and bring about a state of inconsistency, which provokes fantasies. From Piranesi to Paul Delvaux, De Chirico to M.C. Escher and Anselm Kiefer artists have repeatedly surprised us with spatial fantasies that seemed inconceivable. That can also be said without reservation of Martin Kasper, who would definitely have no objections to being included in this tradition.

Bruchstücke/Spiegelfragmente, Hrsg: Velten Wagner, Texr: Martin Kasper und Velten Wagner, 2016
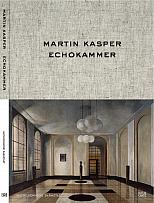
Martin Kasper, ›Echo Chamber‹, editor: Ralf Beil, Text: W.G.Sebald, Inger Christensen, Ralf Beil http://www.hatjecantz.de »
more»
more»
Atelier-, Architektur- und Figurenporträts: Resonanzräume menschlichen Seelenlebens
Martin Kasper (*1962 in Schramberg) verwandelt architektonische Räume durch seine Temperagemälde in Schauplätze seelischer Befindlichkeit: Es entstehen Orte der Leere, gedankliche Freiräume, Momente gespannter Ruhe und Atmosphären von eigenwilliger Aura. Die neuen Ganzfigurenporträts des Künstlers, in denen die Dargestellten vor den Hintergründen zu schweben scheinen, erweitern die Architekturbilder eindrucksvoll. Die historischen Bildhauerateliers des Museums Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe Darmstadt inspirierten Kasper zu einer Malerei-Installation, die Architektur- und Menschenbilder im gegenseitigen Echo vereint und zugleich den realen mit dem imaginären Kunstraum verschränkt. Der Band dokumentiert die Ausstellung anhand von In-situ-Aufnahmen und bietet so einen lebendigen Einblick in das Gesamtwerk des Künstlers, dessen geheimnisvolle Innenwelten in literarischen Texten, etwa von Inger Christensen und W.G. Sebald, ein weiteres Echo finden.
Ausstellung: Museum Künstlerkolonie, Mathildenhöhe Darmstadt 2.2.–21.4.2014

Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Hrsg: ZEIT Kunstverlag, 2009
more»
more»
1 Bei dem Tanzsaal handelt es sich um „Klärchens Ballhaus in Berlins Mitte“, wie Martin Künzig schreibt: „Korrektur des Raumvergessens“ in Martin Kasper „ausgeräumt“, Solothurn 2007, o.P.2 etwa Observation, 2006 oder Kuznetsky Most, 2008 (Abb. 11)3 etwa Flur, 2008 (Abb. 12)4 z.B. demnächst, 2007 (Abb. 8), Polska II, 2007 oder Zwischen den Türen, 20075 „Ausgeräumt“ hiess Martin Kaspers Ausstellung im Haus der Kunst St. Josef in Solothurn (15. September bis 14. Oktober 2007)6 20067 Franz Kafka „Der Prozess“, 2. Kapitel8 20079 wie Anm. 7, 3. Kapitel10 Dazu ist kein Widerspruch, wenn Bernd Künzig schreibt: „Für Martin Kasper sind es anschauliche Räume , die sich in zentralperspektivischer Perfektion darstellen lassen, und gleichzeitig solche der Anschauung, die das Sehen selbst thematisieren: die Raumdarstellung ist Ausdruck dieser Inszenierung des Sehens. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Faszination des Künstlers für Kinos, Theater, Überwachungszentralen, Wartehallen, und oyers; sie alle dienen diesem Theater der öffentlichen Wahrnehmung.“ In Martin Künzig wie Anm. 111 Konferenz, 2005 oder ohne Titel, 200512 Zum Milosevic-Prozess in Den Haag ist im Jahr 2004 eine ganze Serie von Tribunal-Bildern entstanden.

RAUMERINNERN Hrsg: Wendelin Renn, Städtische Galerie Villingen-Schwenningen, 2007
more»
more»
Martin Kasper's Multiple Places
To paint today is not simply to paint: also involved is speculation about the preconditions and formal and sensory limitations of pictorial art. The first great artistic revolutions of the twentieth century led pictorial art to shed the previously taken-for-granted characteristics of naturalistic representation of reality. This abandoning of the accepted notions – of perspective and plane, of the contrast between surface and background, form and matter, contour and colour, subject and object, the interiority and exteriority of the represented and the perceived, figuration and abstraction, and the dogma of the formal unity of the painted work – emancipated pictorial art from all representational mimicry. Thus the formal and material components of painting took on a specific dynamic which detached them from reality and at the same time offered us a new understanding and perception of the real via the eye and the body. As the heir to these radical shifts, contemporary painting constitutes a subtle, ongoing exploration both of the preconditions, limitations and possibilities of formal and sensory perception of the things represented, and those of its own systems of figuration. This kind of agenda gives rise to a suspension of our habitual perception of reality and calls for a transfiguration of our experience of it. In doing so it reveals itself, above and beyond its visible figuration, as driven by a formal, graphic and pictorial interplay independent of normal perception and taking place in an elusive dimension of emptiness and indeterminacy which subjacently structures our visual and sensory perceptions of places, space and images. This kind of artistic evolution is not simply pictorial. It is equally due to material modifications of our experience of reality. When the body is caught up in rapid movement, the unstable vanishing lines that organise our gaze arrange themselves around an additional dynamic, one overlaid on the first. The eye perceives an independent relocation of formal arrangements in space, separated from each other by intervals of emptiness. This is ecstasy made visible: a disjunction of forms and movements which transforms the nature of the image even as it produces it. Because he adheres to this type of agenda, Martin Kasper can be described as an uncompromisingly modern painter. He is gifted with that critical thinking style disseminated by the German and French Enlightenment which, in the late eighteenth century, was the launchpad for our modernity and then for an experimental art with a leaning to detachment and abstraction. His art is very much that of a trained painter, using the surface of the canvas for subtle, skilful play with figuration, volume, line and colour, with a view to producing the illusion of a visual representation of places in the world; but that art is equally a means of exploring the mental, spiritual and sensory possibilities the painted image offers the human subject in a period largely dominated by images made, produced and circulated by machines and screens. The sheer omnipresence of these images, and the potency of their impact on our perceptions, has often led to statements to the effect that, given their ascendancy in the visual field, painting is now no more than a minor, residual art. And yet, as pictorial art teaches us when taken further, looking and representing do not involve a merely mechanical seeing and reproducing of what is perceived, but rather the discerning and producing of the infinite configurations it contains. These latter are as much sensory and material in kind as they are formal and pictorial, each being capable of achieving visibility in the freely transformed experience. Not that the figurative output of the new media is totally alien in this regard; but in contrast with machine-produced images, the distinctive gesture that is the painter's seems to have retained a more radical power to symbolise the world. This makes it a factor for freedom and inventiveness for the perceiving body, because in its interplay of pictorial rhythms and energies it gives concrete expression to the new laws that orchestrate our ways of seeing. Painting today can no longer afford to appear naively ignorant of the power of image technology and its influence on the body and its perceptions. It is at the core of this kind of tension in the domain of seeing, transposed into the domain of the pictorial, that Martin Kasper's oeuvre is to be situated. One comes away from his work with the feeling that the painted picture – at once classical testimony to a deliberate receptivity to the world as experience, and something subjectively evocative and immobile – encounters and opposes the fiction of a screen/projector as the norm for reality and the business of looking. Involved here is a screen of images that is psychically magnetic and dynamic, but at the same time, in terms of individual experience, the mimetic conveyor of a presence-absence due to the fascinating proliferation of images and their intensity. In this respect, then, the picture as practised by Martin Kasper is no neo-naturalist or objectivist representation, but the setting for a subjective experience of the representation of the world via painted images, in an age technologically dominated by communications media. The view of reality of the human subject concerned here is thus phenomenologically caught up in a dynamic proliferation of perspectives/planes and reflections, of opaque resistances and fluid transparencies. This type of experience can be seen as arising from the impression, inherent in perception, of the presence of a substantial void in things, of an intensification of the lines of flight of our gaze and of a dynamism specific to objects and images. As such, it is the outcome of the existence around us of increasing flows of images and representations, themselves vectored by physical emanations which act directly on the bodily organs. At the same time this dynamism is interrupted by the photograph's fixity and power of reification. To assert the subjectivity of Kasper's painting will seem all the more paradoxical in that most of his pictures are empty of any human or even living figure. They portray urban sites – buildings that are neither real nor fictive – presented in an objective, almost realistic way, but seemingly abandoned. Unlike the works of Edward Hopper, which they resemble in terms of their formal structure, they have been deserted by the human subject. Examples include empty cages in a zoo, vacant pavilions at the Venice Biennale, apartment block lobbies, waiting rooms, corridors, subway stations and staircases, building interiors, a picture gallery, passageways in a hospital, a swimming pool and an exhibition venue undergoing renovations. Seeing them, our first reaction is a sense of immobility, of suspense, as if these places were photographic still lives, representations of a deserted world made up of images more or less devoid of meaning but, curiously, in perfect harmony with each other. Like those of Oskar Schlemmer, these images seem aimed at a balanced encounter between the real and the imaginary, as the perspectives of real space fuse with those of the picture space. What all the pictures have in common is a portrayal of modern places that seem, via their specific structures, to possess the same objective and figural properties: geometrical regularity of volume and form, reflective surfaces, numerous partitions and areas of glass, an architectural approach to depth relationships and spatial dimensions, a host of lines of flight and circulation, overlap of surfaces and volumes, and artificial play with colour and light. Thus we might speak of subject-free painting, of painting bereft of any human subject; but this would be a misinterpretation, for the works are not indifferent to the structure of the viewer's gaze and, indeed, seem reliant upon being looked at. Kasper's painting calls up the subjective mise en scène of the viewer looking at the picture and offers itself as a means of construction and analysis of that looking. In this respect, then, it is very much a critical type of painting, a mise en scène of the present conditions of the viewer's gaze in the empty, proliferating space of a strange painted gallery of places and images. In contrast with the eighteenth century, the locus of our experience is no longer that of complete, direct perception of things by the body, but reception of images of reality already put together and graded – technologically preprocessed – by machines and screens. As for the formal pictorial components born of modernity, we have already, perhaps, unconsciously assimilated them into our experience. Invested by the power of technology with a quasimateriality, images have become, as it were, the very substance of our walls and are now not far from determining their layout. Our hyperurban existence faces us with a kind of screen-future, an image-future in which all built, material surfaces gradually become so many surfaces for projection and for the dissemination of images and reflections – so many screens. These surfaces then seem to us vehicles for reflection, diffraction and refraction, set in an architectonics made up of images that are so many hubs and dispersed reflections of the world we live in. Moreover the image, aided by the cinema, video, lighting techniques and computer-generation, has come to look like a movement-form, scattered with intensities, with kinetic, abstract, concrete traces. The outcome is that we tend to perceive things, and represent them to ourselves, as dynamic, fluid movements – driven by physical signals, by the interplay of forces – which become the apparent form of things. On the picture plane this produces radiating lines of flight that converge and diverge, the result of an interaction between the light fields that give the image its tensional framework. It is as if visible reality has adopted the properties of Alexandra Exter's Centrifuge: an energy-dynamic of shapes and colours made up of luminescences, abstract figures in movement, and interaction between planes and colours. This brings a potent change to the viewing locus, which must now be situated in the experience of a body undergoing an incessant, simultaneous modification of its spatial coordinates – of its own perspective field – which propels it beyond the individual boundaries of perception. Taking our inspiration from the Cubo-Futurists Vladimir Tatlin and Kasimir Malevich, we might call such an experience "non-objective", given that it is determined by the interplay of purely formal structures and that this artificial formal arrangement directly interferes with, and takes the place of, natural perception. These technological systems – these materials which bear us along mentally and physically with their images and intensities – function as internal and external operators for an overall transformation of our perception of reality. To the proliferation of screens is added a heightening of the complexity of the visual phenomena of transparency and reflection within the urban experience. We live surrounded by surfaces that are not only reflective but also transparent, and so give rise to a proliferation of reflections and a dematerialisation of boundaries and supports in constant interaction with each other. Conjointly the flows, the speed, the glass pane and the screen surround us with their effects and intensities. In the same way, each element in Futurist painting possesses its own dynamic charge, so that we observe there a successive interplay of forces. Smooth, closed, open, simulated, veiled, opaque, transparent, reflective, static, dynamic – the material surfaces on which our gaze falls are often paradoxical, whether peopled with images or not. Our gaze spontaneously experiences enormous difficulty in determining the presence of depth and relief, of illusion or reality, and whether or not it is faced with a formal construct or a natural perception. Like the blurred indeterminacy of the reflection, artificial images seem obliged to multiply and mingle with most of our visual perceptions, so as to render them uncertain and displace them. Image and reality can then be confused with each other, the near and the distant can reverse roles, and inside and outside can take each other's places. Even more so, the formal, abstract, pictorial arrangement of things and the gaze can commingle with the form of objects and places. The difference between representation and perception then becomes very tenuous, as if the formal techniques of modern art – those of Constructivism – had really taken over the natural complexion of things so as to free nature of them. Thus the bodies and forms are geometrical figures, depth is a plane, perspective a radiating line, light a tension within colour, movement the direction taken by volumes, and the painting a dynamic exchange between interactive pictorial forces. In this kind of experience our impressions of perspective, horizontality and verticality do not completely vanish, but rather find themselves multiplied, dispersed and diffracted. In the work of Martin Kasper the picture, like some near-frozen image, takes note of all of this, determining and thematicising its effects in a kind of striving for objectivity combined with a pure exercising of pictorial art. It does not imitate reality, it produces a reality of its own. Kasper's images are images of images, the composed, factitious reflection of an artificial reflection. Ultimately all this appears to us as a configuration of the real. Reality becomes the open-ended power of possibilities it is up to us to effectuate. Thus it remains for us only to enter these pictures, for they are not a fictively represented externality placed before us, but one of the possible forms of our subjective experience of things via our sense of sight. The painted picture becomes a space modulator like those created by Moholy-Nagy. Art is no longer separated from life and Walter Gropius's programme can now unquestionably be brought to fruition. The infinitude of possibility is henceforth laid in the hollow of the things of this world, here before our eyes.
Emmanuel Brassat.
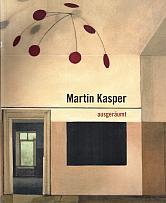
Martin Kasper, ›ausgeräumt‹, Text: Bernd Künzig, hrsg: Haus der Kunst St. Joseph, Solothurn, 2007
more»
more»
Bernd Künzig Martin Kasper’s paintings – stopping spaces from being forgotten
If one tries to find a coherent term to describe Martin Kasper’s painting, then a “memory of spaces” would probably not be a bad choice. This refers firstly to a type of memory that makes us aware of the impressions rooms make. Secondly, it designates a loss, namely how space gets forgotten. The ostensibly photographic precision of Martin Kasper’s images puts us on a false track with this accuracy: He is by no means interested in recording private impressions such as we do with a camera in order to use the images to signal that we have been somewhere and that our presence there was bound up with sensory impressions, stories and encounters. On closer inspection, we can discern the specific painterly gesture by means of which rooms are portrayed here, portraits that may have been based on a photographic image that has then dissolved in the painterly gesture of these paintings. Moreover, Martin Kasper’s paintings are destined for exhibition halls and by no means intended only for private use. They seek primarily to be read as part of a public sphere that addresses social problems by means of aesthetic issues. Most recently, scholarly critique has more strongly highlighted the way we forget space. Sociologist Markus Schroer has authored an important study in which he sets out to establish a “sociology of the room” and in the introduction he draws attention to a fundamental paradox: “On the one hand, space is very real, as it embraces us, we are always ‘within’ it. We can experience a space, enter space, walk around them and leave again. On the other, the room is extremely abstract. While we may still be able to conceive of ‘living space’ as something real, the notion of ‘outer space’ is hardly tangible, because with its infinite expanse and ever expanding scale it defies experience. Faced with the immeasurable scale of space, Pascal noted that ‘the eternal silence in these infinite spaces frightens me.’”1 In the context of a globalized world, we can hear the swansong of space being sung, replaced by the category of time. “What strikes the eye here,” Markus Schroer continues, “is that the hypothesis that space is irrelevant as a category always crops up when the focus turns to economic processes. By contrast, whenever it is political contexts that need to be addresses, the requisite link to space gets emphasized.”2 “While here space disappears, because the distance between previously isolated places can be easily bridged, from a sociological perspective the reverse is true, as space first arises from the mutual attainability of previously isolated places. To this extent we by no means face a successive loss of space. It would be better here to talk of the constant expansion of space, as each medium taps and creates additional space. The fact that we live in the age of space primarily has to do with the fact that things appear to us ever less in the sense of a temporal sequence and increasingly as a spatial sequence. If there is a meaningful definition of the term post-Modernism then it must surely be precisely as that awareness of adjacency that replaces the Modernist notion of sequence.”3 In countless of his images, Martin Kasper has found a visual expression for the adjacency, the simultaneity of space. The spatial concepts used repeatedly see windows and doors opening on the canvas, offering insights or angles of vision into other rooms. The windows and doors that enable this opening into real space as a passage set the frame in the paintings, functioning less as transitions and more to lock pictures of other rooms or spaces together to form a large spatial portrait. Martin Kasper’s spatial images are thus open to the picture-in-the-picture method that so drove the development of modern art since the invention of central perspective in the Renaissance. Only for a short period did the monochrome abstract paintings of the 1950s repel this continuity of a labyrinthine wealth in favor of emptiness. Not least the Renaissance of Surrealism in the context of Concept Art in the 1960s and 1970s returned to the fascinating notion of the picture-in-a-picture, addressing it in terms of political, social and philosophical aspects, asserting the fundamental essence of images as constructs and thus as fiction and rejecting any representational realism. In this regard, Martin Kasper’s oeuvre likewise does not accept the hyperrealistic simulation of photographic realism. Instead, his pictorial works take the Medieval art as their starting point. Medieval heraldry makes use of an telling term for this labyrinthine entanglements of spaces and images: “Mise en abyme” – to place in an abyss. Thus, in the case of Martin Kasper’s images the viewer gazes into the vortex of an abyss of spatial images in which corridors, doors and windows afford views of further rooms and corridors beyond. It is a labyrinth in which the viewer’s gaze gets caught, without being able to be physically present in these visual twists and turns. The fact that for the most part there is an absence of corporeality in Martin Kasper’s room paintings not only relates them to the void but also the openness that can be infused with history and narration. In this sense they are very much related to empty stage-sets. It is no coincidence that on the artist’s desk we find a meticulous documentation of Anna Viebrock’s work – in the past two decades the stage designer fundamentally re-defined this category of the discourse on the image by juxtaposing theatrical portrayal with photographically precise 3D assemblages, whose forceful presence is only bearable thanks to expert production. In the same way that Viebrock’s stark stage designs put the art of portrayal to the test Martin Kasper’s painting likewise puts to the test the dominance of the visual in an age defined by visual media. The acceleration of images we experience through the global Internet is thwarted here. Where computer technology in the sense of the global village seemingly causes space to disappear and seeks through acceleration to dissolve it in hyperactive simultaneousness Martin Kasper’s painting responds with the motionless calm and stasis of empty space, which here in a theatrical sense achieves portrayal, performance and throws the observer back onto his role as observer. Martin Kasper’s painting is not an interactive artwork that wins over the observer by appearing to engage him in a cozy collaboration. Rather it is an internalized personal phenomenon not only the externalization of spaces but their transportation into a personal handwriting that allows us to experience them not least of all as the self-portrait of an artist in the post-modern age. The physical has in fact disappeared to make way for the space we viewers are suddenly reminded of. As such a dancehall like Klärchen’s ballroom in Berlin-Mitte that survived the turn of an era not only reflects the fond nostalgia for East Germany (Ostalgie) that withstood historical upheavals. In the capital’s cultural scene it has long since become a special place for theatrical performance and is itself a spatial performance Martin Kasper explored in three works. It is not only the old “fragrance from fabled times,“ that has manifested itself synaesthetically on the canvas but a consciously dramatic treatment of space that is either captured in a documentary manner in this painting or has become part of the central perspective orchestration that makes this temporal and spatial image become a stage set. However, the actors in this spatial production are not figures, couples and passers-by but the chairs placed on the tables (apparently placed haphazardly in the room) as the silent partners of human tidying-up activities. A chandelier hovers in the upper center as a solitary protagonist. It is a witness of this room which gives away nothing about its experiences. It does not speak of its own volition but is moved to do so by this painting. This chandelier is a somewhat jaded contemporary of a fashion that was already outmoded when it was affixed to the ceiling of this ballroom. It stands for a society aware of its own demise but which tries to compensate for its not having left an impression. The compensation strategy is that of artificiality – something Martin Kasper’s room paintings tend towards to capture the gradual transition to the state of disappearance as an interior. In its denial of everything abstract this painting is related to what Walter Benjamin 19th century described as the prevailing trend of the modern age. What the German philosopher thought of the bourgeois home can be said in the post-modern age of Martin Kasper’s rendering of public space, which is the true subject of this art. It has long since abandoned the private because the decaying public sphere is much more individualist than the identical apartments with their dusky rooms illuminated by the light of computer screens “Since Louis Philippe you can detect in the bourgeois the striving to compensate for the lack of impression his private life leaves in the big city. He tries to do this within his own four walls. It is as if it he had made it a point of honor of not letting - if not the trace of his earthly days then at least his consumer items and requisites - go down in aeons. Untiringly he forms an impression from a wealth of items; for slippers and fob watches, thermometers and egg-cups, for cutlery and umbrellas he tries to get covers and cases. He prefers velour and plush covers, which retain the imprint of every touch. Under the Makart style – the style of the late Second Empire – the home becomes a casing of sorts. He sees it as a case for people and nestles into it with all his accessories, attending to his traces as attentively as nature does a dead fauna in granite.”4 Comparable with Walter Benjamin’s description of the home in the late 19th century, the rooms by artist Martin Kasper, most of which are enclosed in the patina of demise, are likewise such cases. They are emptied, deserted, have become cases for objects and strange things, which only shifted to the focus of attention thanks to the painterly style. The rooms are cases for the chandelier and the chairs in Klärchen’s ballroom. Or in the side room for the accordion lantern that encase the naked lamp. Additional striking elements are the framed paintings that cannot be exactly deciphered: a blurred brown landscape in the side room of Klärchen’s ballroom; a portrait hung too high and below it an illegible commemorative plaque in a railway waiting lounge dominated by checked patterns and green paint; the departure and arrivals boards on the right wall of Tempelhof airport that resemble citations from paintings by Mark Rothko or Helmut Federle with their significant color fields. They expand the picture-within-a-picture strategy of the views through windows and doors or the mirrored rooms (as in Klärchen’s ballroom) to exotic art rooms. In the depiction of a cinema foyer a strange mobile with red circles hovers, which magically attracts the eye and creates a confusing reminiscence of a sculptural object by Alexander Calder. As such, Martin Kasper’s art not only focuses on the entire space but uses it as an oversized case for seemingly trivial objects and items, which have suddenly developed into a realm of the artistic and sculptural. They ensnare the gaze in the details of the room and exert an inward suction movement. As in the theater, the fourth wall of the cube is rendered transparent by allowing the observer access to the other three. The wealth of details draws the gaze into this interior and ensnares it hopelessly inside. Consequently, inside and outside are dialectically opposed. The meticulous painting, which draws on the tradition of the tempera technique requires a closed studio room in order to capture inside as something internalized on the canvas what was an experience made outside. After all, Martin Kasper is a space traveler whose roots are on the earth, for whom it does not suffice to rely on photographic material as inspiration. His portrayals of spaces are generally based on specific experiences and research in the urban settings of highly diverse cities. The experiences which are manifested in the painterly expression of underground stations, waiting lounges, foyers, cinemas, theaters, control centers or television rooms, congeal into silent rooms, which nonetheless hint at their practical function in social, political or cultural spheres, for all that they are hesitatingly portrayed as spheres of human action. Only rarely is the human figure incorporated into this spatial painting. And yet: we are dealing with the stage-sets of social life. In the works that address ape houses in various zoo complexes both man and beast have disappeared. Such rooms are in-depth productions reflecting man’s relationship to the world. They reflect that unfathomable treatment of the alien outside, which is now brought home to become a subdued orchestration of civilization’s appropriation and exploitation: neon-lit gym rooms for drilling the non-European animal nature. For Martin Kasper these are graphic rooms that can be portrayed in central perspective perfection and simultaneously rooms of illustration, which make a topic of seeing itself: the room’s portrayal is an expression of this production of seeing. Ultimately, this explains the artist’s fascination for cinemas, theater, control centers, waiting lounges and foyers; all of them serve this theater of public observation. In portraying space with such complex subtlety that simultaneously employs intimacy and detachment, Martin Kasper’s painting has become a new form of historical painting, which is no longer committed to presenting persons in static arrangements, but attempt to correct the grave spatial oblivion as a deep-rooted historical factor. Martin Kasper’s painting seeks in this correction to let space become the manifestation of human conduct as a political issue, a historical entity and a societal factor. The physical viewer in its politically, culturally and socially colored experience of reality is always also implied in and with these rooms, because although he is not portrayed he is the constitutive factor that gives them meaning when observed. Essentially, these are living portraits.

Martin Kasper, ›Inside‹, Texte: Hans-Joachim Müller, Dietrich Roeschmann, hrsg: Christoph Merian Verlag, Basel, 2005
more»
more»
Im Ruhemodus
Zu den Bildern von Martin Kasper
Grünes Gewölbe. Schmucklos. Aus feudaler Zeit stammt es nicht. Zum Green Cube fehlt ihm die Winkeltreue. Also Zwischenzeit. Zwischen alter und neuer Zeit. Ein Raum mithin ohne Zeit und voller Zeit. Ein Raum, in dem man wartet, dass es Zeit wird.
Waren wir nicht schon dort? Kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Immer führen uns die Bilder von Martin Kasper an Orte, an denen wir schon gewesen sein könnten, wo uns alles bekannt vorkommt und zugleich alles fehlt für die Vertrautheit. Der Wartesaal – im Badischen Bahnhof in Basel – ist leer. Niemand da. Keiner, der wartet, dass es Zeit wird. Hat der Taktfahrplan das Warten überflüssig gemacht? Kein Zug mehr, auf den sich zu warten lohnte?
Wo alle warten, sind alle Opfer der vielen, der zäh vergehenden Zeit. Wo alle warten, sind alle Opfer der vielen, der zäh hängenden Blicke. Warteopfer sind Blickopfer. Jeder schaut dem anderen beim Warten zu, jeder schaut zu, wie ihm beim Warten zugeschaut wird. Das ist ein wenig peinlich. Peinlich ist auch, dass diese Opfergemeinschaft zwangsläufig erträgt, dass die Intimität des Wartens öffentlich geschieht. Was aber, wenn eine Opfergemeinschaft gänzlich fehlt, wenn auf Martin Kaspers Bild der Wartesaal leer bleibt? Dann ist diese Leerstelle wie ein Sog, in den man hineingerät und körperhaft spürt, wie es wäre, wenn man da sässe – und eben nicht allein da sässe. Ein Wartesaal-Bild mit Wartenden würde davon handeln, was ungemütlich ist an Raum und Zeit. Das Wartesaal-Bild ohne Wartende handelt von uns, von Widerstand und Widerstandslosigkeit, von der Faszination an leerem Raum und leerer Zeit.
Börse, Bowlingbahn, Konferenzhalle, Schaltzentrale, U-Bahn-Station, Gerichtssaal, Bar, Kino, Restaurant, Autogrill. Nie ist mit der Einladung in diese Bildräume Aufgehobenheit versprochen, angenehmes Unterkommen, nie Behüttung oder Behütung. Seltsam kalt erscheinen die Interieurs. Immer herrscht dieses kranke Licht, die labortechnische Ordnung, die Asepsis der Pathologie. Zum Wohlfühlen ist das nicht. Dazu erscheinen die Räume zu offen, zu weit aufgeschnitten. Irgendwo geht es stets weiter: nach links, nach rechts, nach hinten, nach oben, um die Ecke. Und selbst der hermetisch wirkende Saal der Broker und Börsianer ist nur Relaisstation unaufhaltsamer Kapitalflüsse. Es sind Bühnen für festgelegte Auftritte, eingerichtet für Kommen und Gehen, nicht für Ankommen oder Bleiben. Durchgangsräume – wie der Wartesaal.
Und doch ist niemand da, der käme oder ginge. Niemand, der auf seinen Auftritt wartete. Die wenigen Figuren gehören zur skulpturalen Staffage, sie bevölkern, beleben die Räume nicht. Die Frau in der U-Bahn-Station scheint den Luftzug kaum zu verspüren, der ihr die Mantelschösse auseinander bläst. Sie steht wie Säule oder Pfeiler, und wenn jetzt ein Zug vor ihr hielte, sie stiege nicht ein. Der Kellnerkopf hinter dem Tresen im Restaurant Alex bildet mit Tellerstapel, Gläserset und Lichtspot ein veritables Stillleben. Dass von ihm viel Handlung ausginge, wäre schwerlich zu behaupten. So wenig wie die Gäste im riesenhaften Bowlingcenter in irgendeine Spielhandlung vertieft scheinen. Niemand handelt, nichts geschieht auf diesen Bildern – ein seltsamer Kontrast zu den opulenten Zurüstungen für mögliche Handlung und Geschehen.
Leuchtkörper in Ufo-Dimension. Sessel wie Torsi. Stabstellen, als würde hier das Schicksal der Welt entschieden. Auf den ersten Blick scheint die überzeichnete Möblierung einer surrealen Tradition zu folgen. Und man meint, solche Kulissen gut zu kennen. Aber wenn man die Stücke benennen will, die hier spielen müssten, dann fehlen die unzweifelhaften Titel. Erinnert das Ambiente nicht an Hollywoods Wille und Vorstellung? Aus welchen Filmen stammt, was da im fahlen Licht wie Hauptquartier, Kommandobrücke, Kontrollstation, Steuereinheit oder Rechenlabor anmutet? Die Stimmung schwankt zwischen Raumschiff Enterprise und Weltvernichtungssalon à la Dr. No. Aber wer da was lenkt und leitet und Rettung oder Untergang beschliesst, das wird nicht verraten. Dass es um wichtige Dinge geht, um bedeutende Ereignisse, das scheint gewiss. Nur dass sich keiner zeigt, der Verantwortung übernehmen wollte, kein einsamer Held, keiner aus dem unsterblichen Titanengeschlecht.
Trocken, fast beiläufig wird das geheimnisvolle Nebeneinander der schieren Ereignislosigkeit und des pathetischen Ereignisvorscheins inszeniert. Wie ein dünner, fast transparenter Schleier liegt die Farbe auf der Leinwand, und nie gerinnt sie zu einer deckenden Haut. Nimmt man die Durchsichtigkeit als Zeichen eines reflexiven Vorbehalts beim Bildermachen, dann hat man zugleich ein Motiv für das ganze Werk. Malerei scheint nur noch möglich, wo sie sich ihrer Schritte und Teile bewusst bleibt, wo sich das Bild bei seiner Bildwerdung selbst begleitet. So – im Denkverhältnis zu sich selbst – darf sich Malerei auch noch einmal auf ihren alten sinnlichen Zauber verlassen und entdeckt ihre enormen Möglichkeiten, indem sie gerade nicht – wie noch die Avantgarden des 20. Jahrhunderts es taten – sämtliche neuen Bildtechniken simuliert.
Man kann Statik und Statuarik dieser Bilder, die gefrorenen Situationen, die Handlungsarmut auf entleerten Bühnen, diese blockartige Wucht der Dinge und Architekturen auch als malerische Strategie gegen die zeitgenössischen Beschleunigungen verstehen, gegen die Verflüchtigungen, die Instabilität, den hektischen Stoff- und Ideenwechsel, der aus einer innovationsgetriebenen Kultur resultiert. Malerei muss nicht neu sein, wenn sie souverän sein kann. Und was sich da so irritierend unbeschwert an der Tradition misst, sollte nicht missverstanden werden als Rückzug oder Verteidigung. Näher kommt man dieser Malerei, wenn man ihre Verzögerungen, Reduktionen, Schematisierungen zeichenhaft begreift, als ebenso überlegte wie überlegene Option gegen das virtuelle Phantasma dieser Jahre.
Ruhe auf der Bowlingbahn. Vertagung im Konferenzsaal. Handelsschluss an der Börse. Nichts los im Café. Martin Kaspers Stills sind nicht einfach angehaltene Filme. Sie sind inszeniert, mit künstlichen, künstlerischen Mitteln in den Ruhemodus gebracht. Willentlich vereinfacht, geometrisiert, entrümpelt. Nirgendwo Dekor. Alles fehlt, was überflüssig, was nur Beiwerk wäre. Kein vergessener Zettel im Hippodrom, in der U-Bahn-Station nichts auf dem Boden, blanke Tische im Restaurant, Theke ohne Kuchen, Bar ohne Flaschen. Als ob der Maler seine Räume erst einmal ausgeräumt, Leben und Lebensutensilien weggeschafft, an Tischen und Regalen die Beschläge demontiert und keine losen, formlos herumstehenden Gegenstände zugelassen hätte.
Soll man dazu Abstraktion sagen? Oder ist es gerade umgekehrt, findet hier eine zögerliche Wiedergewinnung von Gegenständlichkeit, behutsame Gegenstandssuche im Fundus der gegenstandsvergessenen Moderne statt? Sie weiss – und gerade darin erweist sich die Intelligenz dieser Malerei –, dass alle Schlachten schon geschlagen sind, dass es nichts mehr durchzukämpfen gibt, dass man sich nicht mehr auf die Seite des einen oder des anderen zu stellen braucht, weil alles nebeneinander Bestand hat, die Abstraktion und die Gegenständlichkeit, die Figürlichkeit und die Gestik, die Malerei und die aufgelösten Kunstformen. Sie weiss, dass das eine nicht für Fortschritt und das andere nicht für Rückschritt steht, und es keine medialen Anwälte mehr braucht, um vorzugeben, was an der bildhaft gewordenen Welt noch Anspruch auf Bedeutung erheben kann.
Die Grunderfahrung der Zeit ist die der inkommensurablen Verfügbarkeit. Alles liegt schon getan vor einem. Und wenn es auch nicht so ist, dass damit alle Rätsel gelöst und alle Geheimnisse gelüftet und alles Wissbare verstanden wäre, dann erlebt sich Bewusstsein, das keinerlei Utopien mehr verpflichtet ist, doch mitgerissen vom Strom der vermessenen Dinge und der unermesslichen Ereignisse. Und es behauptet sich, indem es da und dort andockt, dies und jenes besetzt, aussucht, verknüpft, kaleidoskopartig zusammenstellt, zum Netz aufspannt, aber nichts mehr aufzuhalten braucht wie die utopiegläubigen Generationen zuvor und nichts mit immer neuer Neuschöpfer-Grandiosität überbieten muss.
Alle Wege sind bezeichnet. Was ja nicht heisst, dass man nur noch den vorgespurten Pfaden folgen könnte. Noch immer gehört es zu den intelligenten Kulturtechniken, seine Wege selber zusammenzustellen. Trotz GPS. Das tritt mit keinem geringeren Anspruch an als mit umfassender Kenntnis aller Wegedaten. Und wer sich darauf verlässt, wird auch kaum sein Ziel verfehlen. Aber das bedeutet nicht, dass er gezwungen wäre, der Computerstimme zu folgen. Niemand verbietet ihm, Umwege zu fahren, seine eigenen Abkürzungen zu suchen. Er kann, wenn man so will, das GPS überlisten. Intelligente Malerei heute ist so etwas Ähnliches wie GPS-Überlistung. Mit List geht sie ihren Weg – mitten durch den Wahn der vollends erschlossenen Welt.
Welt, das sind die Bilder, die wir uns von der Welt machen. Sollte man bei Martin Kaspers Bildern sagen ‹gedämpfte Welt›? Ein wenig stumpf sieht diese Welt ja aus, trocken, leicht verschattet, entrückt, entfernt, durch ein opakes Okular gesehen. Und die Dinge erscheinen wie abwesend, nicht ganz hier zu sein, von weit hergeholt, aus der Erinnerung belichtet, festgehalten auf einem Film, der alle Töne nach Moll hin moduliert. Das schafft eine eigentümliche Stimmung. Aber die ‹gedämpfte Welt› ist kein romantisches Paradigma, kein Sehnsuchtsmotiv, indiziert nicht Traum oder Halbwachheit. Alles ist hier überaus bewusst. Keine Zufälle, nichts was einfach geriete, was wie von selbst so würde. Man muss das betonen, weil gerade die konstruierte Unschärfe das Zeitgenössische dieser Bilder ausmacht.
Malerei heute kann nicht mehr so tun, als ginge es noch immer darum, die Dinge einfach umzusetzen, sie von ihrem Dingsein in den Zustand des Gemaltseins zu heben. Sie weiss vielmehr, dass zwischen dem Dingsein und dem Gemaltsein immer schon das Bildsein ist, dass die Dinge nicht anders und nicht eigentlicher erfahrbar sind denn als Bilder. Auch Martin Kaspers gemalten Bildern gehen in der Regel fotografische Bilder voraus. Bilder aber existieren nicht in der stofflich begrenzten Form des Gegenstands mit festen Dimensionen und festen Bestimmungen. Bilder verweisen aufeinander. Sie sind immer zugleich Bilder von Bildern, existieren nur in der dynamischen Form der Referenz. Ihre Ränder verfliessen. Was zwischen den Rändern ist, bleibt vage, die Beziehung ist Unschärferelation. Das, nichts anderes meint die eigentümliche Unschärfe auf Martin Kaspers Bildern.
Wenn die Stopp-Signatur dieser Malerei – das zum malerischen Verhaltensmuster gehörende Anhalten, Leeren und Warten – als Metapher für Abständigkeit gelten darf, dann bietet solche Distanz eine doppelte Chance: für eine Neueinstellung der Sehschärfe und zugleich für die Wiederentdeckung der Dinge in der Unschärfe. Gerade im Abbau der Formen- und Dingfülle erlebt diese Malerei, wie die Formen und Dinge uneindeutig werden, magisch. Und dann thront der Bildschirm wie eine konstruktivistische Skulptur auf dem Sockel, und die futuristische Bar verwandelt sich in eine medizinische Apparatur und die U-Bahn-Station in ein Bühnenbild für ein melancholisches Einpersonenstück.
Und zum Schluss wird aus dem Einpersonenstück dann doch wieder ein Keinpersonenstück. Wie beim schmucklos grünen Gewölbe, von dem man nur sagen kann, dass es nicht aus feudaler Zeit stammt und ihm zum Green Cube die Winkeltreue fehlt. Mehr lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Es sei denn, man sagte es so unbestimmt, wie die Malerei im unscharfen Dazwischen bleibt, irgendwo zwischen alter und neuer Zeit. Wenn man es so sagen könnte, dann müsste man vielleicht sagen: Ein Raum, in dem niemand wartet, weil es längst Zeit geworden ist.
Hans-Joachim Müller

›Malerei Jetzt‹, hrsg: Bernd Künzig, Bühl, 2006
more»
more»
Martin Kasper: Der Raumfahrer
In jüngster Zeit hat die wissenschaftliche Kritik verstärkt auf die Raumvergessenheit hingewiesen. Der Soziologe Markus Schroer hat mit einer grundlegenden Untersuchung sich bemüht, an einer „Soziologie des Raums“ zu arbeiten und dabei einleitend auf ein grundlegendes Paradoxon aufmerksam gemacht: „Auf der einen Seite ist der Raum sehr konkret, da er uns ständig zu umgeben scheint, wir uns ständig ‚in‘ ihm aufhalten. Wir können Raum erfahren, können Räume begehen, betreten und wieder verlassen. Auf der anderen Seite ist der Raum äußerst abstrakt. Können wir uns unter ‚Lebensraum‘ noch etwas Konkretes vorstellen, scheint schon der ‚Weltraum‘ nicht mehr recht fassbar, weil er sich in seinen unendlichen Weiten und seinen immer noch expandierenden Ausmaßen unserer Erfahrung entzieht. Schon Pascal notiert angesichts dieser Unermesslichkeit des Raumes: ‚Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.‘“ Dieses Pardoxon und das Erschrecken vor dem Schweigen treibt den Maler Martin Kasper mit seinem bildkünstlerischen Schaffen um. Innen und Außen stehen sich in solch obsessionellem Tun dialektisch Gegenüber. Die sorgfältige Malerei, die sich der handwerklichen Tradition der Tempera-Technik bedient, bedarf des geschlossenen Atelierraums, um in diesem Innen als Verinnerlichtes das auf der Leinwand zu bannen, was als Erfahrung im Außen gemacht wurde. Denn Martin Kasper ist ein irdisch verhafteter Raumfahrer, dem es keinesfalls genügt, von fotografischen Vorlagen zu zehren. Seine Raumdarstellungen basieren in der Regel auf konkreten Erfahrungen und Recherchen in der Urbanität verschiedenster Metropolen. Die Erfahrungen, die sich in der malerischen Darbietung von U-Bahn-Stationen, Wartehallen, Foyers, Kinos, Theatern, Überwachungszentralen oder Fernsehräumen niederschlagen, gerinnen zu schweigenden Räumen, die dennoch auf Gebrauchszusammenhänge des Sozialen, Politischen und Kulturellen verweisen, wenngleich sie zögernd als humane Aktionsräume dargestellt werden. Nur recht verhalten und verstärkt erst in den letzten Jahren ist die menschliche Figur in diese Raummalerei eingezogen. Und dennoch: es handelt sich um Bühnen des Gesellschaftlichen. In den jüngsten Arbeiten, die sich mit Affenhäusern verschiedener Zooanlagen befassen, sind sowohl Tier und Mensch wieder verschwunden. Gerade derartige Räume sind fundierte Inszenierungen der Beziehung von Mensch und Welt. In ihnen schlägt sich jener abgründige Umgang mit dem fremden Außen nieder, das nun heimgeholt zu einer unterkühlten Inszenierung der zivilisatorischen Aneignung und Ausbeutung geworden ist: neonerleuchtete Turnräume für den Drill des außereuropäisch Kreatürlichen. Für Martin Kasper sind es anschauliche Räume, die sich in zentralperspektivischer Perfektion darstellen lassen und gleichzeitig solche der Anschauung, die das Sehen selbst thematisieren: die Raumdarstellung ist Ausdruck dieser Inszenierung des Sehens. Daraus erklärt sich nicht zuletzt die Faszination des Künstlers für Kinos, Theater, Überwachungszentralen, Wartehallen und Foyers; sie alle dienen diesem Theater der Wahrnehmung. Wenn Martin Kasper sich in seiner „Tribunal“-Serie mit Porträts von Richtern, Zeugen, Anwälten und Angeklagten des Kriegsverbrecherprozess um den ehemaligen Serbenführer Slobodan Milosevic auseinandersetzt, dann umkreisen diese Darstellungen der menschlichen Figur in ihren sozialen und politischen Rollen erneut einen Raum, der ihre Handlungen und ihre daraus resultierenden Abbildungen im Porträtieren von Haltungen, Gesten und Gesichtsausdrücken begründet. Dies ist jener Gerichtsaal des internationalisierten Tribunals, in dem Geschichte und Verbrechen zu einem durchorganisierten, rationalisierten kühl inszenierten Akt des Aufarbeitens geworden ist. Mit dieser komplexen Hintergründigkeit einer Raumdarstellung von gleichzeitiger Annäherung und Distanzierung ist die Malerei Martin Kaspers zu einer neuen Form der Historienmalerei geworden, die nicht mehr der Inszenierung von Personen in statischen Bildern geschuldet ist, sondern die gravierendere Raumvergessenheit zu korrigieren versucht. Die Malerei Martin Kaspers sucht in dieser Korrektur den Raum als Politikum, als historische Größe und als gesellschaftlichen Faktor zum Ausdruck des Humanen von Handlungsweisungen werden zu lassen. Der Betrachterkörper in seiner politisch, kulturell und sozial bestimmten Erfahrungswirklichkeit ist immer selbst in und mit diesen Räumen gemeint, weil er deren in der Darstellung abwesender, aber in der Betrachtung anwesender konstituierender Bedeutungsfaktor ist.

›Flashback‹, hrsg: Dorothea Strauss, Kunstverein Freiburg, Freiburg, 2005

›Painting on the Move‹, hrsg: Bernhard Mendes Bürgi, Peter Pakesch, Basel, 2002
›Zeitgenössische Kunst am Oberrhein‹, hrsg: Stadt Offenburg, Franz Huber Verlag, 2001

›Abbild, recent portraiture and depiction‹, hrsg: Peter Pakesch, Springer Verlag, Wien, 2001

Martin Kasper, ›Treibstoff‹, Text: Ralf Beil, hrsg: Galerie Daeppen und Galerie Schwarz, 2000
more»
more»
Treibstoff oder: Die Macht der Farbe Ralf Beil In: Katalog der Ausstellung in der Kunsthalle Bremerhaven
Was verbindet das Trinkwasserreservoir einer kanarischen Insel mit einem Rhône-Kraftwerk und einer Tankstelle im Breisgau? Es ist Martin Kaspers Malerei. Für einige Zeit vereinigt in der Einzelausstellung der Kunsthalle Bremerhaven, beweisen seine Bilder wieder einmal, daß Kunst im besten Fall immer schon das Ereignis einer neuen Perspektive ist. Martin Kasper selbst spricht von "Malanlässen", wenn die Rede auf seine Motive kommt. Der 1962 im schwäbischen Schramberg geborene Maler lebt und arbeitet in Freiburg, doch er braucht regelmässig Streifzüge und ausgedehntere Reisen, um sich mit dem Basismaterial seiner Kunst zu versorgen. Kameranotizen von Architektur in Landschaft - "Rohphotos", wie Kasper es ausdrückt - bilden die Grundlage seiner malerischen Recherchen, an dessen Ende Realitätskonzentrate von eindrücklicher Intensität stehen. Paradigmatisch für diesen künstlerischen Destillierungsprozess ist die Leinwand "Flughafen", entstanden im letzten Jahr. Fasziniert von der strengen Glasarchitektur vor sanftem Hügelhorizont, die er bei der Landung auf der Insel Teneriffa vorfand, hat der Künstler binnen Minuten vom Rollfeld aus eine ganze Anzahl Photos geschossen. Später, zurück im Atelier, hat dann die eigentliche Arbeit begonnen: Kasper hat das ausgewählte Motiv von allem berflüssigen, jedem nicht wesentlichen Detail geschieden, es von jeglichen Fahr- und Flugzeugen sowie Menschenansammlungen geleert. So ist am Ende von dem emsigen Touristenumschlagplatz nurmehr ein strenger Gebäuderiegel übriggeblieben, der scharfkantig den Landschaftsprospekt zerschneidet und zugleich dessen Kraftzentrum ist. Die seltsame Spannung, die von diesem Kasper-typischen Querformat ausgeht, wurzelt nicht nur in der pointierten Frontalität des Gebäudes sowie der Leere des Bildes, sondern auch in der eigentümlichen Kargheit der Temperamalerei selbst. Ähnliches könnte man auch von der Leinwand "Sassnitz" sagen, deren kühner Komplementärkontrast sich weder in den ursprünglichen Kameranotizen noch in Goethes "Farbenlehre" im Atelierregal findet. Machtvoll trifft mattiertes Pariserblau und Türkis auf latent giftiges Gelb, umso machtvoller stösst die Landungsbrücke auf der Kaimauer ins schwefelfarbene Nichts vor. Seit 1995 visualisiert Martin Kasper solche Orte gespannter Ruhe und kurios energetischer Aura. Bis vor kurzem kamen vor allem Kaliminen, Hebewerke, Schleusen, Stauseen und Wasserkraftwerke ins Bild. In jüngster Zeit nun hat er insbesondere den "Malanlass" Tankstelle für sich entdeckt. Nur ein Maler hat vor Martin Kasper Tankstellen derart prominent zum Bildmotiv erkoren: Edward Hopper. Doch wo Hopper mit seiner "Mobilgas-Station" atmosphärisch die Einsamkeit des archetypischen Vorpostens amerikanischer Zivilisation auf die Leinwand bannt, interessiert Martin Kasper etwas ganz anderes. Bei aller Möglichkeit zu atmosphärischer Verdichtung, wie sie sich etwa in "T 10" manifestiert, wo der Gebäuderumpf der Tankstelle unter tristem Graublau mit seinen Fensterschlitzen regelrecht zu äugen beginnt: Martin Kaspers "Tankstellen" sind - wie "T 9" und insbesondere "T 11" belegen - primär Farb- und Formereignisse, die, per se stark gegliedert durch horizontale Lichtbänder und Farbstreifen, in ihrer massiven Frontalität und monumentalisierenden Totale unweigerlich zu bildnerischer Abstraktion tendieren. Nur auf den ersten Blick mag es verwundern, dass Kasper, befragt nach Malern, die ihn derzeit besonders beschäftigen, ausgerechnet Kasimir Malewitsch und Rupprecht Geiger nennt. Je länger man sich mit seinen neuesten Werken auseinandersetzt, umso schlüssiger wird die Wahl des Künstlers. Dürfte ihn an Geigers Werken die geradezu körperliche Intensität der Farbe reizen, so sind es bei dem grossen Russen insbesondere die nachsuprematistischen Streifenbilder, die mit Realitätszitaten arbeiten, diese aber gekonnt formalisiert im Schwebezustand zur Abstraktion halten. Der "Malanlass" Tankstelle hat Martin Kaspers Malerei grundlegend verändert. Wie sehr, dass lässt sich an seinen Bildern von Kraftwerken und hochalpinen Betonbauten aus den Jahren 1997 und 1998 ablesen: "Rhône 3" etwa oder "Brenner". Zwar beherrschen auch dort Totale und Horizontale die Komposition, doch hat diese Malerei der spröden Leimfarben in ihren verhalten tonigen Valeurs und atmosphärischen Hell-Dunkelkontrasten einen ganz eigenen Reiz. In Martin Kaspers Werdegang sind sie heute fast schon "klassisch" zu nennen. Auch wenn sich die "Tankstellen"-Serie im Vergleich dazu noch mitten in ihrer Entwicklungsphase befindet, so zeichnet sich bereits jetzt ein eminenter Gewinn für den Künstler ab: Fest steht, dass Martin Kaspers Erkundungen auf dem Terrain der Farbe ihn in noch unerforschte Gebiete seiner Kunst zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, detailgenauem Realismus, abstrahierender Unschärfe und roh belassenen Leerstellen geführt haben. Fest steht ferner, dass dies sein ganz eigener Beitrag und zugleich Ausweg aus der Malereidiskussion unserer Tage ist. Mögen die puristischen Positionen von Realismus und Abstraktion längst zum Klischee oder blossen historisch-ironischem Zitat verkommen sein und als Extremwerte der Malamplitude nicht mehr befriedigen - dazwischen gibt es noch immer genug Welten zu entdecken. Martin Kasper hat seine Personale in der Kunsthalle Bremerhaven "Treibstoff" genannt. Man mag es durchaus auf die kaum zufälligen Ausgangspunkte seiner malerischen Recherche beziehen - auf Flughafen, Kraftwerk oder Tankstelle, allesamt Passagenorte, Relaisstellen technisch-mechanischer Bewegung, Treibstoffbasen im eigentlichen wie bertragenen Sinn. Wichtiger scheint mir jedoch die energetische Bedeutung des Begriffs für ihn selbst. In der Kunsthalle Bremerhaven hat Martin Kasper zum ersten Mal öffentlich vorgeführt, was er im letzten Jahr als eminenten "Treibstoff" für sich entdeckt hat: die Macht, ja Opulenz der Farbe.
›Regionale 2000‹, Text: Peter Pakesch, hrsg: Peter Pakesch, Kunsthalle Basel, 2000
›Malerei aus Baden-Württemberg‹, hrsg: Künstlerbund Baden-Württemberg, 1999

Martin Kasper, ›Kraftwerke‹, Text: Siegmar Gassert, hrsg: Ausstellungsraum Büchsenhausen, Innsbruck,1997